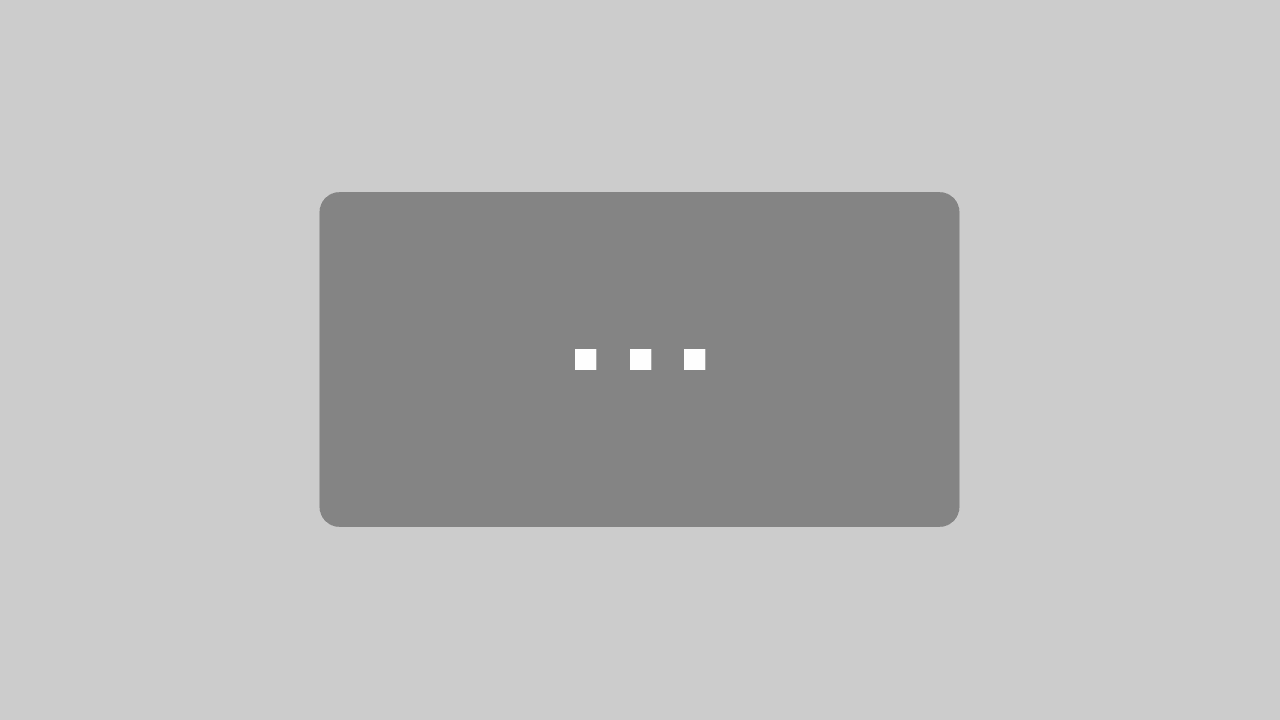„Never change a winning team” ist in Unternehmen ein beliebter und meist zutreffender Slogan. Wenn man mit den gleichen Methoden und gleichem Personal bisher Erfolge gefahren hat – warum sollte man etwas ändern? Doch das gilt nicht für alle Aufgaben. Besonders in der Strategiearbeit und beim Einsatz von Strategietools kann man sogar zu routiniert werden.
Wird in einer Organisation die Strategiearbeit einfach „wie immer“ abgearbeitet, führt dies direkt in die Routinefalle. Wer nur sein Tool zur Hand nimmt und wie Vorjahr und Vorvorjahr die Matrix neu ausfüllt, vermeidet die Auseinandersetzung damit, was sich verändert hat und was sich verändern muss. Es lohnt sich deswegen, einen genauen Blick auf Strategietools und ihren jeweiligen Beobachtungsauschnitt zu werfen. Die Werkzeuge und Methoden, mit denen man unter Umständen schon seit Jahren arbeitet, fühlen sich vielleicht noch so wirkungsmächtig wie zu Beginn an – doch der Markt, seine Akteure und die Herausforderungen verändern sich. Und wo immer das gleiche Tool zum Einsatz kommt, bleibt man blind für die Handlungsoptionen, die erst durch einen Wechsel in den Blick kommen würden. Zum einen weil sich äußere Einflüsse verändern, zum anderen weil man mit einem neuem Tool einen neuen Blick wagen kann und so neue Handlungsoptionen gewinnt. Beachtet man ein paar Stolpersteine in der Strategiearbeit, kann sie ein erfrischender Neuanfang sein, das Team ausrichten und Themen adressierbar machen, die im Daily Business gerne untergehen.
Im mikropolitischen Dickicht der Organisation
Strategietools werden eingesetzt, um Objektivität zu erreichen. Dabei führen sie zum Gegenteil: Sie spiegeln immer die mikropolitische Gemengelage einer Organisation oder eines Teams. Ob SWOT oder Wettbewerbsanalyse – kein Tool ist neutral. Es konzentriert sich auf Ausschnitte, auf vorher festgelegte Themen und Parameter. Welche von ihnen in den Fokus gerückt werden und welche außen vorbleiben, sind Entscheidungen, die in der Mikropolitik der Organisation ausgehandelt werden müssen. Akteure, die sich hier mikropolitisch gut positionieren können, bringen das Tool nach vorne, das ihre Interessen und Perspektiven unterstützt.
Was als Schwäche, was als Stärke gewertet wird, hängt von den Positionen der Teilnehmenden in der Organisation ab.
Wie heikel dadurch Strategie-Arbeit sein kann, wird oft unterschätzt. Ein Beispiel: Ein Pharmaunternehmen setzt einen SWOT-Workshop (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) an. Es soll also um die Identifikation von Stärken und Schwächen der eigenen Produkte und die der Wettbewerber gehen, um Möglichkeiten und Bedrohungen – wie zum Beispiel neue Therapie-Leitlinien oder Behandler-Präferenzen. Die SWOT-Analyse erleichtert es ihren Teilnehmenden erst einmal, kritische Punkte anzusprechen – denn ihr Ziel ist es, verschiedenste Perspektiven und Aspekte zu sammeln. Man muss aber ganz klar sehen: Was als Schwäche oder Stärke gewertet wird und wie viel Gewicht diese Bewertung hat, hängt von den Positionen der Teilnehmenden ab – sie ist also eine Frage von Macht, Einfluss, Zugehörigkeit. So ist zum Beispiel ein Biomarker aus Sicht der medizinischen Funktionen ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Marketing würde sich für die Marktbearbeitung aber vermutlich eher eine All-Comer-Strategie wünschen.
Gemeinsame Planung schützt vor Überraschungen
Mit den Potenzialen und Limitierungen vor Augen, kann es sich lohnen schon vor dem eigentlichen Strategieworkshop mit den Kolleg:innen in die Debatte zu gehen, mit welchen Tools man arbeiten möchte. Wer aus der Logik von Research & Development denkt, wird mehr über Möglichkeiten nachdenken wollen als Mitarbeitende im Sales-Bereich, die den Fokus auf die Schwächen existierender Produkte legen, da sie diese in der Diskussion mit den Behandler:innen diskutieren müssen.
Es sollte auch eine Verständigung über den genauen Gegenstand der Analyse geben. Das kann am Beginn eines Workshops geschehen – das birgt allerdings die Gefahr von Überraschungen und einer Ausrichtung des Programms, dem nicht alle Mitglieder folgen wollen. Oder: Man findet vorab im Team eine Abstimmung. Das kann mehr Arbeit bedeuten als eine kurze Diskussion vor Arbeitsbeginn, doch wird so die Zusammenarbeit aller wahrscheinlicher, da man gemeinsam entschieden hat. Fragen, die vorab geklärt sein sollten, sind etwa: Welcher Leitfrage gehen wir genau nach? Welche Kundensegmente betrachten wir genauer? Eine dritte Option kann für Führungskräfte sein, die Themensetzung im Vorfeld selbst zu bestimmen – für sie eine Chance, die eigene Agenda auf den Tisch zu bringen und sich dafür vorab Verbündete zu sichern. Noch etwas granularer gilt die mikropolitische Überlegung auch in der Bearbeitung der Tools z.B. für die Entscheidung, welche Punkte in der SWOT bis in die Tiefe verfolgt werden – und welche nur kurz angerissen werden.

Es werden immer blinde Flecken bleiben
Ob SWOT, Strategic Gaming oder Situationsanalyse – der Einsatz von Strategietools spiegelt immer die dahinterstehenden mikropolitischen Perspektiven. Die Parameter, über die verhandelt wird, sind nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, betonen einen speziellen Blickwinkel und müssen daher als Weichenstellung verstanden werden. Dass es „blinde Flecken“ gibt, sollte man sich immer wieder bewusst machen – es gibt kein Tool, das die Wirklichkeit als Ganzes in den Blick nehmen kann. Kommt es in Teams oder Organisationen zu Auseinandersetzungen über die Wahl von Strategietools, steht dahinter oft das Motiv: „Diese oder jene Blickrichtung passt aber besser zu meinen Zielen“. Jede beteiligte Fraktion will ihr Handeln bestätigen oder rechtfertigen, denn Schwächen werden Akteuren oft als Fehler ausgelegt. Um die Themensetzung wird deshalb bereits vorab gerungen, damit der eigene Kunde oder die eigene Substanz nicht schlecht aussehen. Im ungünstigsten Fall entzieht sich der Akteur dem Tool ganz.
Ergebnisse umsetzen – auch wenn es weh tut
Die letzte Gefahr, die Strategieworkshops innewohnt, ist ihre abstrakte Ebene. Es ist zu leicht, die Ergebnisse hinzunehmen, sie als umzusetzende Ziele auszuflaggen – aber die konkreten Fragen zu umzuschiffen: Was genau nehmen wir mit? Was setzen wir wie genau um? Bei wem liegen nun welche Verantwortlichkeiten? Welche Hebel fasst man zuerst an? Diese Fragen führen genauer auf die Umsetzung hin und stellen damit sicher, nicht auf einem allzu bequemen Scheinkonsens zu verbleiben. Wenn nach einem Workshop alles wie vorher ist, lief etwas falsch. Es muss Konsequenzen geben. Die können schmerzhaft, aber auch befreiend sein.
Der Schritt, ins Handeln zu kommen wird in den meisten Tools nicht mehr ausbuchstabiert – sie sind auf Ergebnisproduktion in Form von Text angelegt, nicht auf Aktionen. Wichtig ist, dass es eine Verständigung darüber gibt, was die größten und vielversprechendsten Hebel sind. Denn erst in einzeln gegliederten Operationen, die einer Priorisierung und einer Ausrichtung an der aktuellen Lage der Organisation folgen, wird aus einem Strategie-Tool ein für die aktuelle Situation des Unternehmens brauchbares Werkzeug – und ist nun alles, außer ein einfaches Routinewerkzeug.