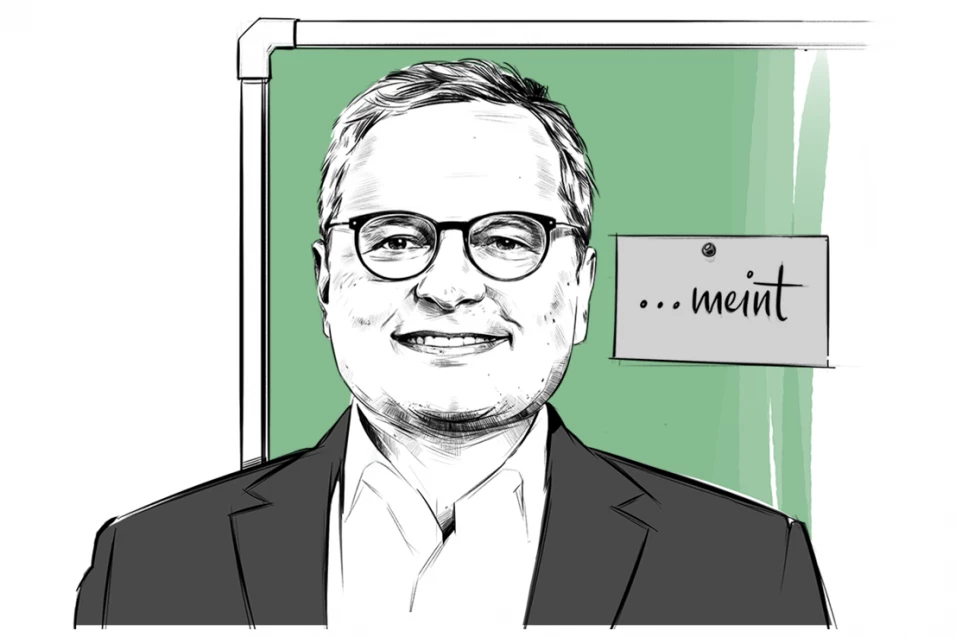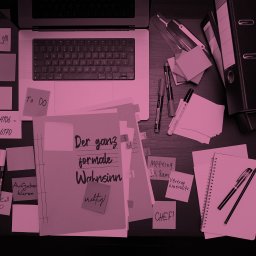Organisationen haben eine Superkraft: Sie können sich selbst die Regeln auferlegen, die kollektiv bindend sind. Das können Familien nicht, das können auch Freundesgruppen nicht, jedenfalls nicht in gleicher Form. Doch wie bei jeder Superkraft gilt auch für diese, dass ihr Einsatz manchmal mehr schadet als nützt.
In dem Zusammenhang musste ich neulich an Sylvia denken. Sylvia war Führungskraft in einem rasch wachsenden IT-Unternehmen. Ein „scale up“, würde man heute sagen. Es gab keine andere Richtung als nach oben: mehr Breite, Tiefe, mehr Leute, mehr Umsatz. Das Wort „Blase“ stand schon irgendwo an der Wand , aber niemand las es, weil alle nur aufs Wachstum schauten.
Damit diese Entwicklung ungehemmt weitergehen konnte, musste Sylvia die Struktur der Organisation verändern. Man hatte bisher nur wenig formalisiert. Das machte irre flexibel, war aber gleichzeitig irre unübersichtlich. Wer sollte mit wem üblicherweise zusammenarbeiten, an wen berichten? Wie sollten Vertrieb und Entwicklung verzahnt werden? Was war die richtige Struktur für die Zukunft? Projektorientierung? Kundenorientierung? Ordnung nach Funktionen? Oder eine Matrix?
Auf diese Fragen Antworten zu finden, wäre Aufgabe genug gewesen. Doch hatte Sylvia es zusätzlich mit einem selbst ernannten „harten Kern“ unter ihren Mitarbeitenden zu tun, die am strukturlosen Zustand festhalten wollten. Aus deren Sicht lag der Erfolg des Unternehmens gerade darin, dass wenig fest entschieden war. Darin stecke die Chance, situativ neue Arbeitszusammenhänge zu bilden, einfacher in Projekte zu starten, schlicht mehr Kreativität zu entfesseln. „Never change a winning team“, war ihre Maßgabe. Doch aus Sylvias Sicht hatte man so viel gewonnen, dass man nun eine Liga aufsteigen würde – und in der würde man sich anders aufstellen müssen.
Der „harte Kern“ hatte sich kaum um die Erweiterung seiner Fähigkeiten bemüht, und war davon überzeugt, die aktuellen Fähigkeiten würden schon ausreichen. Deshalb würde die neue Aufstellung wahrscheinlich ohne sie stattfinden müssen. Sylvia hatte also eine Reihe ernster Gespräche vor sich. Bloß: Sie hatte nichts außer ihrem persönlichen Eindruck, um ihre Argumente zu untermauern. Deshalb entschied sie sich, das unternehmerische Äquivalent von „Wir schreiben jetzt einen Test!“ durchzuführen: ein Assessment mit all ihren Mitarbeitenden.
Unter dem Vorwand, die Neuorganisation des Bereichs werde besser gelingen und die Qualifikationen der Mitarbeitenden könnten besser gewürdigt werden, wenn man mehr Daten über sie hätte, ließ man den gesamten Bereich eine Reihe von Tests und Planspielen durchlaufen. Das Ergebnis war wie erwartet: Der „harte Kern“ war den Anforderungen des Unternehmens nicht gewachsen. Allerdings wurden die Gespräche mit den Mitarbeitenden trotz des Assessments nicht einfacher. Ob Sylvia ihre Position allein auf ihrer Perspektive oder ihre Perspektive auf die Testergebnisse stützte, machte für den unangenehmen Charakter der Gespräche keinen Unterschied.
Nur für die anderen Mitarbeitenden, die in schlaflose Nächte darüber nachdachten, das Ergebnis des Assessments könnte womöglich sein, man brauche sie nicht mehr – für sie hätte es einen Unterschied gemacht, hätte es nie ein Assesment gegeben.
Es ist für uns vermeintlich strukturverliebte Metaplanerinnen und Metaplaner eine ungewöhnliche Position, aber: Manchmal braucht es keine neuen Strukturen, keine weitere Ebene an Formalia, auf die man sich stützt. Manchmal muss man das unangenehme Gespräch ohne Geländer führen.