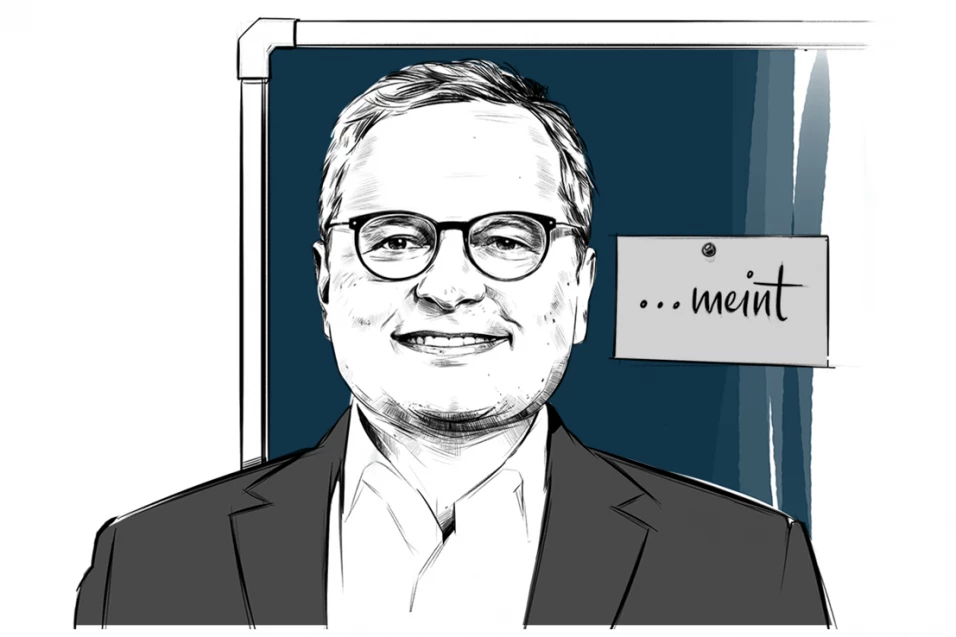„Erst die Unterscheidung zwischen Mensch und Mitglied erlaubt es der Organisation, ihre Eigendynamik ungestört von menschlichen Eigenarten zu entfalten. Sie kann ihre Mitglieder ausschließlich in ihrer Organisationsrolle adressieren und ihre persönlichen Motive außer Acht lassen.“ So schreiben wir es in unserem Buch „Die Humanisierung der Organisation“. Fordern wir hier die Rückkehr zum Taylorismus?
Natürlich nicht.
Es geht nicht darum, dass etwa ein Unternehmen seine Angestellten zur Arbeit antreiben und dabei ignorieren darf, was es mit ihnen persönlich macht – ob sie in der Lage sind, das Aufgabenpensum in der Arbeitszeit zu schaffen, ob die Art der Arbeit ihnen auf die Psyche schlägt, etc.
Man denke nur an die aktuelle Situation in Krankenhäusern. Den meisten Mitarbeitenden im Gesundheits- und Pflegebereich kann man sicher ein persönliches Interesse unterstellen, Menschen helfen zu wollen (selbst wenn es sich als Patient:in manchmal anders anfühlt). Andernfalls würden sie die großen und kleinen Absurditäten ihres Alltags kaum ertragen. Wenn dieser Wunsch, Menschen zu helfen, aber nicht nur freundlich zur Kenntnis genommen, sondern von der Organisation genutzt wird, um Mängel in der Struktur auszugleichen, handelt die Organisation übergriffig.
Wenn es in einem Krankenhaus zur Routine wird, dass Mitarbeitenden mehr oder minder offen erpresst werden, dass niemand außer ihnen da ist, um den Patient:innen zu helfen, dann geschieht genau das Gegenteil von dem, was wir mit „persönliche Motive außer Acht lassen“ meinen. Man appelliert nicht nur an ihre Motive, sondern gleichzeitig noch ans Gewissen und die Menschlichkeit. Wenn dass alles nicht hilft, wird an die Kolleg:innen erinnert, denen eine besonders zermürbende Schicht bevorsteht, wenn man jetzt nicht einspringt. Wir haben diesen Mechanismen, mit welchen Organisationen sich von ihren Mitgliedern mehr holen, als ihnen zusteht, übrigens ein eigenes Kapitel gewidmet („Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht“, S. 35 – 54).
Für die Betroffenen ist es sehr belastend, sich gegen dieses übergriffige Verhalten abzugrenzen. Es kann sich wie Verrat an den eigenen Idealen anfühlen, wenn man zum Wohle der eigenen Gesundheit oder der Fortexistenz eines Privatlebens der Organisation (in Form von Teamleitungen, aber auch verzweifelten Kolleg:innen) den Zugriff auf alles entzieht, was nicht formal als Teil des Jobs besprochen wurde.
Aus unserer Sicht ist es eine der wichtigsten Aufgaben von Organisationen, ihre Mitglieder nicht in solche Dilemmata laufen zu lassen. Sie müssen Strukturen schaffen, in denen die jeweiligen Aufgaben erfüllt werden können, ohne dass zusätzlich noch persönliche Ressourcen gebraucht werden.
Persönliches Engagement ist nicht verboten – nur manchmal irritierend
„Außer Acht lassen“ bedeutet auch nicht, persönliches Engagement in einer Organisation gehöre untersagt. Mitglieder können sehr wohl ihre persönlichen Ressourcen in die Organisation einbringen. Sie tun es auch ständig: Wenn sie „ganz schnell“ selbst Probleme am Computer lösen, anstatt die IT zu involvieren (was organisationsübergreifend IT-Abteilungen auf die Palme bringt), wenn sie ihre Hobbykamera-Ausrüstung zum Event mitbringen und bessere Bilder schießen als die Profis, wenn sie ihr persönliches Netzwerk aktivieren, um Kund:innen zu akquirieren oder Neuigkeiten zu verbreiten.
In diesen Fällen handelt es sich um freiwilliges, persönliches Engagement, welches die Organisation meistens wohlwollend zur Kenntnis nimmt: Sie bekommt mehr, als verlangt wurde. Es kann allerdings zu Irritationen kommen, wenn dieses persönliche Engagement mit den eigentlichen Aufgaben in der Organisation kollidiert. Wenn die Quartalsauswertung bis Freitag fertig werden soll, kann man eine Verspätung nicht damit legitimieren, dass man den ganzen Tag für die gesamte Bürobelegschaft Kuchen gebacken hat. Auch nicht, wenn das anstrengend war. Dort, wo man in einer Organisation den Ausruf „Aber darum hatte dich doch niemand gebeten?!“, hört, hat man es meistens mit einem solchen Problem von „zu viel“ persönlichem Engagement zu tun.
Als Ausnahme können Rollen gelten, die bereits formal ein besonderes Maß an persönlichem Engagement erfordern. Etwa wenn Kreativität gefordert ist, oder Verantwortungsübernahme für Entscheidung in einer unsicheren Zukunft. Dann ist es nötig, persönliche Initiative zu zeigen, was aber auch persönlich angreifbar macht.
Ganz typisch ist diese Anforderung für Stellen im Management. Hier ist die Situation für den Einzelnen besonders anspruchsvoll. Während die Organisation anscheinend nach der ganzen Person greift, muss das jeweilige Mitglied gleichzeitig professionellen Abstand waren. Denn weil die eigene Person so stark mit den getroffenen Entscheidungen verknüpft wird, ist wenig so gut als Signal für einen „Neustart“, „Zeitenwende“ und „Kurswechsel“ geeignet, wie die Mitteilung, dass Organisation und Person fortan getrennte Wege gehen.
Ab und zu muss man sich an die eigene Austauschbarkeit erinnern
Und dies ist der abschließende Grund, wieso man zwischen Menschen und Mitglied unterscheiden sollte: Mitglieder sind austauschbar. Menschen dagegen einzigartig. Wenn ein Mitglied einzigartigen Status erreicht und unersetzbar für die Organisation geworden ist, hat die Organisation ein Problem. Manchmal auch das Mitglied selbst, denn wenn man über eine Leistung oder Wissen verfügt, das niemand anders in der Organisation hat, wird man auch bei Krankheit, Urlaub und nach Feierabend noch kontaktiert.
Es ist deswegen hilfreich für beide Seiten, die eigene Ersetzbarkeit nicht zu vergessen. Das ist nicht als Drohgebärde gemeint. Für die Organisation ist es eine wichtige Grenze: Sie darf nicht alles haben. Für den Menschen ist es die Erinnerung: Du existierst auch ohne diese Organisation. Ein Großteil deiner Persönlichkeit, deiner persönlichen Motive, entzieht sich ihrem Zugriff. Das hat sie gefälligst zu respektieren.
Tut sie das nicht, ist es absolut legitim, „die Mitgliedschaftsfrage zu stellen“ – und zu gehen.