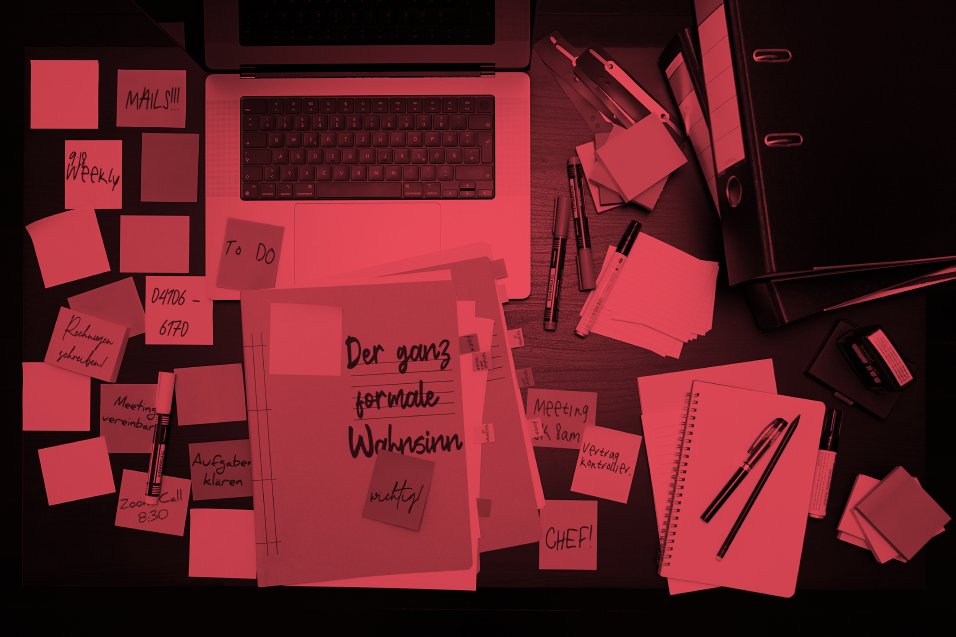„Beste Band der Welt sucht Plattenfirma.“ Mit dieser Anzeige suchte Anfang der 1990er Jahre die Punkband „Die Ärzte“ eine Plattenfirma. Beim Lesen dieser Anzeige stutzt man – sind doch solche Formen der Selbstdarstellung eher ungewöhnlich. Man stelle sich nur Kleinanzeigen vor, in denen die „wohl beste Studentin der USA“ einen Arbeitsplatz sucht oder der „vielleicht bestaussehendste Mann Asiens“ nach einem entsprechenden weiblichen Gegenstück fahndet. Die Erfolgschancen wären wohl eher gering.[1]
Viele haben schon von ihren Eltern und Lehrern eingetrichtert bekommen, dass „Bescheidenheit eine Zier“ ist, und wir kennen diese „Ächtung des Selbstlobs“ aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Der Latin Lover, der allzu offensiv seine sexuellen Fähigkeiten preist, weckt bei der interessierten Weiblichkeit eher Misstrauen gegenüber seinem tatsächlichen Können. Eine Universität, die sich zu aggressiv als exzellent präsentiert, wird Irritationen bei potenziellen Studierenden auslösen.
Eigenlob stinkt
Hierbei ist es zweitrangig, ob der Leistungsanbieter „in Wirklichkeit“ kompetent ist oder nicht. Allein die „mitgeteilte Kompetenz“ macht misstrauisch. Der Latin Lover mag im Bett eine Kanone sein, aber das marktschreierische Hinausposaunen dieser Fähigkeiten reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass er dort auch landen wird. Die Universität Bielefeld mag in einer ganzen Reihe von Fächern eine „exzellente Universität“ sein, doch wenn sie sich selbst als eine solche deklarieren und nicht durch das Lotteriespiel irgendeines Wissenschaftsrates zu einer solchen erkoren würde, schadete ihr eine derartige Selbstdarstellung sogar.
Auch eine mehr oder weniger verkleidete Variante der Kompetenzdarstellung kann ähnliche Effekte erzeugen. Wenn ein Professor auf seiner Website, in den Klappentexten seiner Bücher oder in den Ankündigungen zu seinen Vorträgen damit wirbt, dass er einmal von einer Wirtschaftszeitschrift als „Zeitmanagement Papst“ bezeichnet wurde, verweist er zwar auf die Kompetenz- (oder vielleicht eher Prominenz-)zurechnung anderer, löst aber allein schon durch die Wiedergabe des Zitats auf seiner (!) Website Irritationen aus.
Das Problem des vermeintlichen Zeitmanagement Papsts liegt darin, dass ein Wortbeitrag oder auch nur eine kleine Geste anderer allzu offensichtlich instrumentell eingesetzt wird, um die eigene Kompetenz darzustellen. Man sagt etwas oder zeigt etwas, aber letztlich will man etwas ganz anderes als das Gesagte oder Gezeigte zum Ausdruck bringen. Johann Wolfgang von Goethe, der hier schon aufgrund der Kompetenzdarstellungsnotwendigkeit des Autors zitiert werden muss, hat das Problem bereits vor zweihundert Jahren prägnant auf den Punkt gebracht: „So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.“
Kompetent wirkt besonders der, der Kompetentes tut
Derartige Beobachtungen drohen immer, zu einer psychologisierenden Analyse zu führen. Die Kompetenzdarstellung wird als persönliches Problem von pubertierenden Jungmännern, von zu sehr von sich eingenommenen Professoren oder von narzisstischen Beratern identifiziert: Da habe jemand, so die häufige vorsoziologische Zurechnung, ein Ego-Problem oder agiere sozial ungeschickt. Dies mag in einzelnen Fällen sicherlich richtig sein. Selbst wenn Soziologen tratschen (was sie häufig tun), kann man beobachten, wie debattiert wird, dass der Kollege Peterson mal wieder den dicken Max markiert hat, oder man kann registrieren, wie im Klatsch andere (und leider manchmal auch man selbst) bei der Einhaltung der zentralen „Selbstlob-Ächtungs-Regel“ mal wieder kläglich versagen. Aber für diese persönlichen Zurechnungen ist eher die Psychologie zuständig. Für die Soziologie ist ein anderer Punkt interessant: Die soziale Notwendigkeit, in vielen Situationen kompetent zu erscheinen, ohne dabei in Selbstlob verfallen zu dürfen.
Im Arbeitsleben – insbesondere in Bereichen, in denen mit Klienten gearbeitet wird – ist man gezwungen, nicht nur kompetent zu agieren, sondern auch Kompetenzvermutungen zu mobilisieren: Ein Friseur ist darauf angewiesen, seinen Kunden die eigene Kompetenz zu signalisieren, damit diese ihn beim Schneiden ihrer Haare möglichst wenig reinreden und stören – und damit sie überhaupt erst den Auftrag geben, ihnen die Haare zu schneiden. Eine Rechtsanwältin muss ihrer Mandantin vermitteln, dass sie das zugrunde liegende Rechtsproblem beherrscht – und zwar unabhängig davon, dass vermutlich kein Anwalt in der Lage ist, komplizierte Rechtsfälle ohne genaues Studium entsprechender Gesetzeskommentare bearbeiten zu können. Ein Beratungsteam muss dem Klienten die Sicherheit vermitteln, dass es ein Problem lösen kann – und zwar auch dann, wenn es das erste Mal auf so ein Problem stößt und keine bewährten Routinen für dessen Lösung hat.
Man kann dieses Phänomen beim Arzt- oder – häufig noch schlimmer – Friseurbesuch kleiner Kinder beobachten. Kinder haben noch keine Kompetenzvermutung gegenüber Ärzten und Friseuren. Deshalb gestaltet sich deren Behandlung in der Regel schwieriger als die von Erwachsenen. Die Dienstleistungserbringer sind daher bemüht, das Vertrauen ihrer jungen Kunden zu gewinnen. So werden beispielsweise Vertrautheitssurrogate in Form der beruhigenden Anwesenheit von Eltern aufgebaut, bevor die ärztliche Untersuchung oder der Haarschnitt beginnt. In ihrem weiteren Lebensverlauf entwickeln sich Kinder dann – jedenfalls meistens – zu Klienten, die den Leistungserbringern mehr oder minder berechtigterweise mit einer Kompetenzvermutung gegenübertreten.
Gerade Berufe, die ihre Leistung am Klienten oder sogar in Kooperation mit diesen erbringen, stoßen auf dieses Paradox: Ein Leistungserbringer muss seinem Klienten erst vermitteln, dass er ihm bei seinen Problemen kompetent helfen kann, weil es sonst nur schwer möglich ist, ihm überhaupt zu helfen. Eine Lehrerin kann ihren Schülern nur dann etwas beibringen (so schon eine alte pädagogische Binsenweisheit), wenn die Schüler – in ihre Kompetenz vertrauend – mitarbeiten. Eine Psychoanalyse setzt eine Serie gelungener Interaktionen zwischen Analytiker und Klient voraus. Damit die Interaktion mit dem Klienten gelingt, ist es notwendig, dass dieser die Aneinanderreihung von „Hmms“ nicht als Sprachfehler des Analytikers, sondern als kompetente professionelle Gesprächsführung begreift. Aber wie macht man das? Wie erzeugt man Kompetenzvertrauen? Sicher nicht durch penetrante Kompetenzbehauptungen – aber wie sonst?
Die Notwendigkeit, seine Kompetenzen darzustellen, kann je nach Tätigkeit unterschiedlich verteilt sein: Ein Polizist braucht seine Kompetenz zur Nutzung einer Pistole in der Regel nicht unter Beweis zu stellen. Man bringt ihm – jedenfalls meistens – schon aufgrund seiner durch die Uniform signalisierten Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe eine Kompetenzvermutung bei der Nutzung einer Pistole entgegen. Einem Piloten begegnet der Kunde – vorausgesetzt, er leidet nicht unter pathologischer Flugangst – mit einem so hohen Maß an Kompetenzvermutung, dass in der Regel keine zusätzlichen Kompetenzdarstellungen durch die Pilotin benötigt werden. Überspitzt ausgedrückt: Echte Profis brauchen keine Kompetenzdarstellungskompetenz.[2]
Die Berufs- und Professionsforschung hat sich in Berufsprestigestudien immer wieder mit der Frage beschäftigt, welche Beschäftigtengruppen in der Bevölkerung am kompetentesten eingestuft werden. Bei der Messung der Reputation von Berufen schneiden die Professionen seit Jahrzehnten stabil und fast überall auf der Welt stets am besten ab. Wenn Menschen gefragt werden, welche Berufsgruppe sie am meisten schätzen und bei wem sie am meisten Kompetenz vermuten, gehören die klassischen Professionen der Ärzte, Richter sowie Anwälte, Lehrer und Geistlichen immer zu den am höchsten bewerteten Berufsgruppen. Auf den hinteren Rängen landen fast ausschließlich Berufe wie Journalisten, Politiker, Prostituierte oder Manager, die zwar ihre Leistungen in Interaktionen mit ihren Klienten erbringen, aber nicht als Profession mit standardisierter Ausbildung und beschränktem Berufszugang etabliert sind.
Echte Profis brauchen keine Kompetenzdarstellungskompetenz
Professionen wird schneller vertraut
Diese Kompetenzvermutungen gegenüber Professionen basieren nicht alle auf langen Erfahrungen in konkreten Interaktionen zwischen Professionsangehörigen und Klienten. Sie werden vielmehr durch eine Vielzahl von „Institutionen“ gestützt, die jenseits des eigentlichen Gesprächs zwischen Leistungserbringern und Klienten liegen: das Sich-darauf-Verlassen, dass der Tätigkeit des Professionellen ein standardisierter Verhaltenskodex zugrunde liegt, der es ermöglicht, „Kunstfehler“ überhaupt zu identifizieren, eine wissenschaftliche Verankerung dieses standardisierten Verhaltenskodexes, die Gewissheit, dass der Professionelle sich diesen Verhaltenskodex in einer mehrjährigen Ausbildung angeeignet hat, und die Sicherheit, dass sich die Profession in einer Form selbst kontrolliert, die es ermöglicht, „Kunstfehler“ zu identifizieren und zu sanktionieren.
Durch diese Verselbstständigung der Kompetenzvermutung haben Professionen „Inszenierungsvorteile“ gegenüber Nichtprofessionen. Die Familienanwältin braucht der ihre Scheidung betreibenden Ehefrau nicht erst die zentralen Paragraphen des Familiengesetzbuchs aufzusagen, damit sich diese auf ein Arbeitsbündnis einlässt. Der Geistliche kann sich, jedenfalls im Erstkontakt, auf die Reputation seines Berufsstands verlassen und der Klient vermutet erst einmal, dass er einigermaßen predigen, die Beichte abnehmen und die zu kritischen Lebenslagen passenden Bibelstellen rezitieren kann. Dem Mediziner wird insofern vertraut, als man – jedenfalls bei Standardbehandlungen – dazu bereit ist, sich einen Praktiker aus dem Telefonbuch herauszusuchen. Erst bei schwerwiegenderen Eingriffen zieht man weitere Quellen wie Empfehlungen durch Bekannte oder das Internet heran.
Natürlich gibt es auch bei etablierten Professionen wie Juristen, Medizinern, Geistlichen oder Lehrern Fälle übermäßig inszenierter Kompetenzdarstellung. Diese deuten jedoch in der Regel auf mehr oder minder ausgeprägte Krisen hin: Wenn junge Ärzte mit einem für sie unbekannten Problem konfrontiert werden, kann man häufig beobachten, dass sie zunächst auf der Hinterbühne heimlich im „Klinikleitfaden“ blättern, um sich Orientierung zu verschaffen, und anschließend gegenüber dem Patienten mit übertriebener Kompetenzdarstellung auftreten. Bei jungen Lehrern, die durch eine Klasse unter Druck gesetzt werden, lässt sich nicht selten beobachten, wie sie die Situation dadurch verschlimmern, dass sie zu aggressiv versuchen, ihre Kompetenzen, die von den Schülern in Frage gestellt werden, darzustellen. Doch normalerweise sind Mitglieder von Professionen vom Zwang zur übermäßig offensiven Kompetenzdarstellung befreit, weil sie sich zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Kompetenzvermutungen der Klienten gegenüber Professionen stützen können.
Kompetenz kann man einem ansehen
Diese Kompetenzvermutung gegenüber Professionen kann man an dem wohl prominentesten Kleidungsstück einer Profession verdeutlichen: dem Arztkittel. Vorsoziologisch wurde der Arztkittel immer wieder als notwendiges Instrument zur Kompetenzdarstellung einer Profession interpretiert. Der Arztkittel sei, so die auch immer wieder in Cartoons aufgegriffene Vermutung, Ausdruck ärztlichen Standesbewusstseins. Erst im und durch den weißen Kittel würde der Arzt zum Arzt werden. Interessanterweise fällt aber auf, dass viele medizinischen Praktiker keinen Kittel tragen: Psychiater tragen ihn nicht, Kinderärzte legen sehr selten einen an und Hausärzte tragen ihn immer weniger.
Wie wenig Ärzte auf eine Kompetenzdarstellung durch den Arztkittel angewiesen sind, lässt sich in einem Realexperiment beobachten, dass von Clare Murphy eindrucksvoll geschildert wurde. Nach einer Vorgabe des Gesundheitsministeriums sollen Mediziner in Großbritannien keine weißen Kittel mehr tragen. Hintergrund: In vielen Staaten haben gerade die Infektionen durch gegen antibiotikaresistente Stämme wie Staphylococcus aureus oder Clostridium difficile in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben den Krawatten der Ärzte sind Arztkittel die Hauptüberträger dieser Infektionen. Sie werden, so zeigen Studien, seltener gereinigt als Alltagskleidung. Statt des Kittels empfiehlt das britische Gesundheitsministerium das Tragen von Hemden mit kurzen Ärmeln oder T-Shirts, die täglich gewechselt werden. Nur wenn mit Blut, Eiter oder Exkrementen hantiert wird, sollte mit Plastikschürze, Einmalhandschuhen und Mundschutz gearbeitet werden, die unmittelbar nach der Behandlung entsorgt werden. Überraschend ist, wie problemlos sich die Abschaffung des Arztkittels in Großbritannien durchzusetzen scheint. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die hauptsächliche Funktion von Arztkitteln – gerade in Krankenhäusern – darin besteht, den Patienten eine schnelle Identifikation des ärztlichen Personals zu ermöglichen. Aber gerade dafür gibt es auch andere, weniger infektiöse Möglichkeiten: Namensschilder.[3]
Der Darsteller muss wissen, wie er ankommt
Bei der Darstellung von Kompetenzen gilt die Regel: Je indirekter die Kommunikation, desto besser. Das Aushängen von Diplomen ist sicherlich eine eher ungeschickte und auch nur im angloamerikanischen Kontext akzeptierte Praxis. Die Hinweise einer Sekretärin, wie gefragt ihre juristisch, medizinisch, seelsorgerisch, therapeutisch oder beraterisch aktive Chefin ist, wirken glaubwürdiger, als wenn die Chefin selbst Derartiges vermittelt. Die Selbstpräsentation als „keynote speaker“ auf irgendwelchen Internetportalen wirkt peinlich, während die Fremdbeschreibung als „hervorragende Rednerin“ nicht als übertriebene Kompetenzdarstellung wahrgenommen wird. Die Selbstdarstellung einer Universität als „exzellent“ auf ihrer Website würde Irritation auslösen, aber es schadet nicht, wenn ganz andere Stellen – irgendwelche Wissenschaftsräte oder Zentren für Hochschulentwicklung – eine Uni als exzellent markieren.
Aber „Die Ärzte“ – gemeint ist nun wieder die Punkband und nicht die Profession – haben vermutlich die beste Lösung für das Problem gefunden: eine ins Maßlose übertriebene Kompetenzdarstellung, vorgetragen mit einem ostentativ ironischen Unterton. Es gehört eine hohe Kunstfertigkeit dazu, dieses ins Absurde gezogene Selbstlob mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Ironie über einen längeren Zeitraum durchzuhalten und sicherlich lässt sich diese Lösung auch nicht ohne Weiteres beispielsweise auf den akademischen Betrieb oder das Überleben in geselligen Interaktionen übertragen. Doch wenn sie funktioniert, hat man das Problem des Selbstlobs ein für alle Mal aus der Welt geschafft.
[1] Karg, Markus (2001): Die Ärzte – Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf. Für ausführlichere Fassungen des Beitrages siehe Stefan Kühl: Ächtung des Selbstlobs und Probleme der Kompetenzdarstellung. In: Thomas Kurtz, Michaela Pfadenhauer (Hrsg.): Soziologische Kompetenzforschung 2008. und ders.: Die verflixte Sache mit der Kompetenzdarstellung. In: Uwe Schimank, Nadine Schöneck (Hrsg.): Einladung zur Soziologie. Frankfurt a.M., New York 2008, S. 37–47.
[2] Für den Begriff der Kompetenzdarstellungskompetenz siehe Michaela Pfadenhauer: Professionalität. Opladen 2003.
[3] Siehe Clare Murphy (2007): Death of the Doctor’s White Coat. In: BBC News, 17.11.2007.