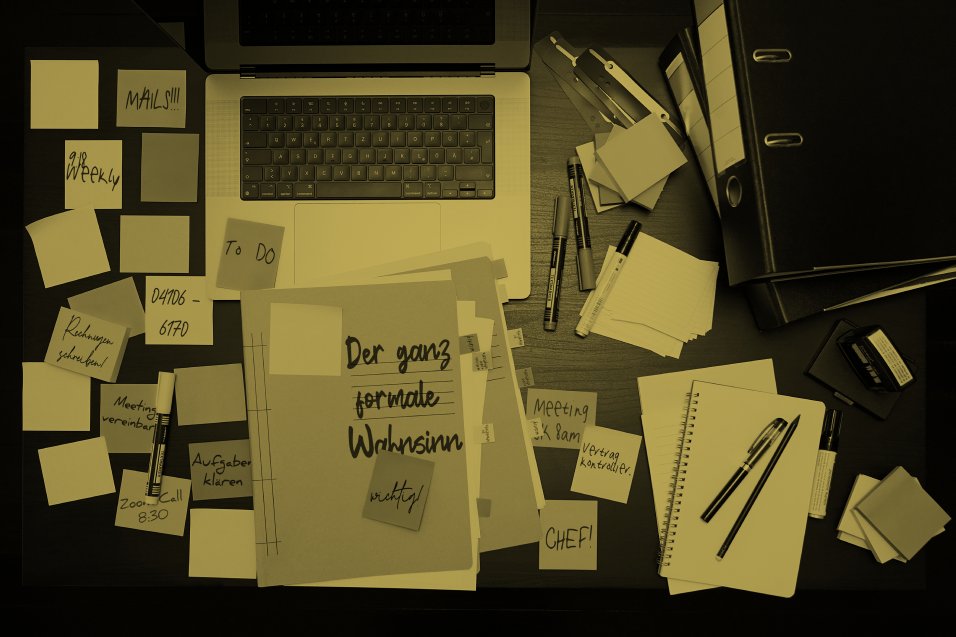Die Stimmung an den Fachhochschulen und Universitäten verändert sich. Vielerorts müssen sich Professoren in Zielvereinbarungen verpflichten, eine genau spezifizierte Anzahl von Abschlussarbeiten zu betreuen und eine festgelegte Anzahl von Artikeln zu publizieren. Verhandelt werden diese Zielvereinbarungen nicht mit Dekanen, die im Sinne der akademischen Selbstverwaltung durch die Wissenschaftler einer Fakultät bestimmt werden, sondern mit Leitungspersonal, das vom Präsidenten der Universität ernannt wird. Werden die Zielvereinbarungen nicht erreicht, können dem Professor Gehalt, Mitarbeiterstellen oder Sachmittel entzogen werden.[1]
Ziel dieser Maßnahmen ist es, so jedenfalls die Steuerungsvorstellung, dass akademische Personal wieder zu Leistungsträgern werden zu lassen. Nur durch die Bindung monetärer und materieller Vorteile an die Erreichung von Leistungszielen sei es möglich, die Professorenschaft daran zu hindern, in eine wohlige Bequemlichkeitsstarre zu verfallen. Nur durch die Übernahme von in der Wirtschaft erprobten Methoden der Mitarbeitermotivation könne es gelingen, den Professor dazu zu bringen sich über seine acht oder neun Pflichtsemesterwochenstunden hinaus zum Arbeiten zu bringen.
Sicherlich mag es die Professoren geben, die in dem Moment ihrer Berufung den Griffel fallen lassen und die sichere Position eines Lebenszeitbeamten vorrangig dafür nutzen, ihr Leben jenseits der Universität zu optimieren. Jeder Student, jede Studentin kennt Geschichten von Freizeitprofessoren, die einmal die Woche an der Universität auftauchen und ansonsten die schöne Einrichtung des Mittagsschlafs pflegen, um abends bei ihren ausgedehnten Bergtouren gut in Form zu sein. Oder es wird von Professoren berichtet, die die Universität vorrangig als Plattform für ihre lukrativen Berater- und Gutachtertätigkeiten nutzen und für Studierende nur noch zu erreichen sind, wenn sie ihr Interesse als Anfrage eines großen Unternehmens oder einer Medienanstalt tarnen.
Weswegen stellen jedoch diese Exemplare die seltene Ausnahme in der Akademie dar, obwohl doch sowohl der Privatleben- als auch der Nebenerwerbsoptimierer scheinbar individual rational zu handeln scheinen? Wie kommt es, dass die Mehrzahl der Wissenschaftler nach ihrer Berufung auf eine Lebenszeitstelle nicht zu allgemein akzeptierten Arbeitszeiten zurückkehren, sondern eher aus der 50 Stundenwoche jetzt eine 60 Stundenwoche macht?
Der Grund für den auf den ersten Blick vielleicht irrational wirkenden Arbeitseifer von Wissenschaftlern liegt in der Wirkmacht einer verdeckten Karrierestruktur in der Wissenschaft. Es gibt in jeder wissenschaftlichen Disziplin Messlatten, mit der die Qualität von Wissenschaftlern gemessen werden kann. Es ist überraschend, wie schnell sich Wissenschaftler darauf verständigen können, wer die „Bringer“ in ihrer Disziplin sind und wer eher abgeschrieben werden kann.[2]
Dieses Ranking findet interessanterweise ganz ohne Zitierindex oder Aufstellungen über eingeworbene Forschungsmittel statt. Selbst in Disziplinen wie Psychologie, Soziologie oder Biologie, die durch heftige Theoriestreitereien gekennzeichnet sind, fällt die große Übereinstimmung darüber auf, wer zu den Koryphäen gerechnet werden kann. Man käme vielleicht nie auf die Idee, den Vertreter einer anderen Schule auf eine Professur am eigenen Institut zu berufen. Und auch bei der Entscheidung über Forschungsmittel zögert man, diese an den Vertreter einer anderen Theorierichtung zu vergeben. Sitzt man dann aber schulübergreifend abends beim Bier zusammen, einigt man sich dann doch überraschend schnell darauf, wessen Artikel zitierenswert sind und wessen man eher ungelesen zur Seite legen kann. Diese Rangordnung spielt bei den alltäglichen Interaktionen zwischen Wissenschaftlern unterschwellig eine zentrale Rolle. In den Diskussionen auf einer Konferenz und in den kleinen Gesprächen in der Kaffeepause schimmert die Rangliste immer durch und wird durch diese Gespräche immer wieder neu austariert.
Das Besondere an der Karriere in der Wissenschaft im Vergleich zu der Karriere in der Wirtschaft, Politik oder Recht ist, dass diese Karrieren nicht an eine Organisation gebunden sind. Der Star in einer Disziplin muss nicht automatisch auch das Sagen in seiner Fakultät haben. Die wichtigen Entscheider in den Instituten und Fachbereichen sind nicht unbedingt auch diejenigen, die im verdeckten Ranking einer Disziplin besonders gut abschneiden. Es gibt sogar böse Stimmen die behaupten, dass Karrieren in den Universitätsgremien negativ mit der Karriere in der Wissenschaft korrelieren.
Vielleicht lässt sich das Engagement in den Gremien nicht nur als notwendige Pflichtübung verstehen, die jeder Wissenschaftler mal erfüllen muss, sondern auch als Kompensationsfläche für mangelnde Reputation auf der verdeckten Karriereleiter der Wissenschaft. Das versteckte Ranking innerhalb der Wissenschaft hätte dann nicht nur den Effekt, das akademische Potential am wissenschaftlichen Arbeiten zu halten, sondern könnte auch das Engagement in der akademischen Selbstverwaltung wenigstens teilweise erklären.
Der Reformeifer vieler Universitäten und Fachhochschulen besteht vorrangig darin, diese verdeckte Karrierestruktur druch vermeintliche objektivierende Bewertungsverfahren zu ersetzen. Aber es ist fraglich, ob sichdie Rangliste durch eine bürokratisch anmutende Sammelwut abbilden lässt. Weswegen sollte man aufwendige und kostspielige Verfahren einführen, wenn dochder akademische Klatsch allein dafür sorgt, dass das akademische Personal am Arbeiten gehalten wird.
[1] Siehe dazu Mathias Binswanger: Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren. Freiburg im Breisgau, Wien 2012.
[2] Siehe zu Reputation einschlägig Niklas Luhmann: Selbststeuerung der Wissenschaft. In: ders. (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Opladen 1970, S. 232–252.