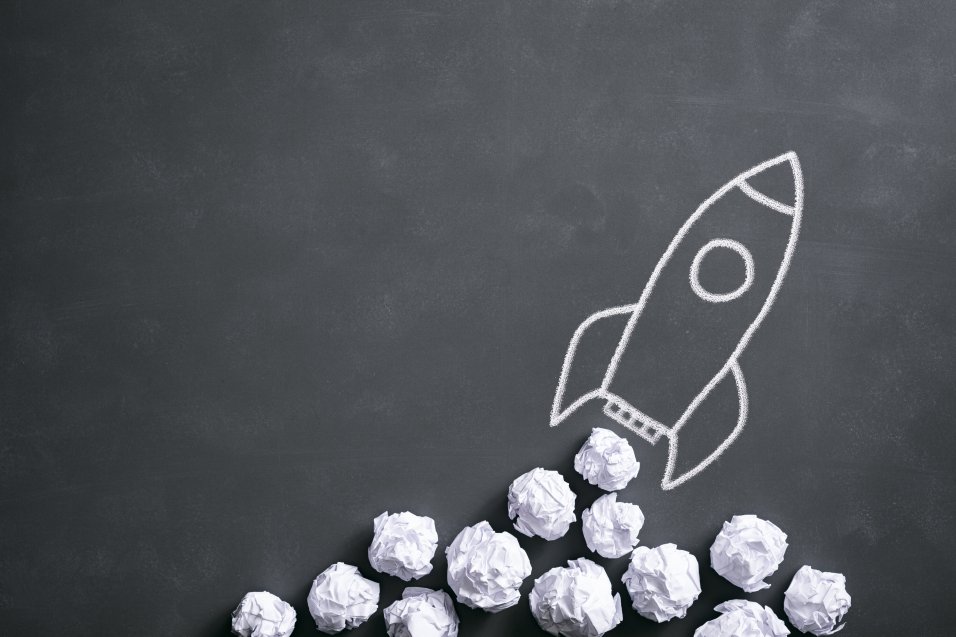Unternehmen legen zuweilen ein merkwürdiges Verhältnis zum Thema Innovation an den Tag. Auf der einen Seite finden sich diejenigen, die für ihren Innovationsgeist gepriesen werden oder sich zumindest selbst als Bastionen der Neuerung begreifen. Auf der anderen Seite stehen solche Firmen, die Aufholbedarf sehen, oder die als unbewegliche Relikte verschrien sind und die – wie könnte es anders sein – sich reichlich Mühe geben, kurzfristige Abhilfe in Aussicht zu stellen.
In beiden Lagern dürften solche (Eigen-)Diagnosen bei Mitarbeitenden nicht selten zu Kopfschütteln führen. Mitarbeitende in (selbst-)ernannten Innovationsfabriken mögen im Alltag die Erfahrung machen, dass sie sich an den Beharrungstendenzen von Hierarchie und Mikropolitik die Zähne ausbeißen. Angestellte auf vermeintlichen Innovationsfriedhöfen hingegen lachen sich vermutlich vielerorts ins Fäustchen – in Anbetracht der innovativen (Um-)Wege, mit denen sie ihre Organisation trotz allem beweglich halten. Das mag daran liegen, dass Innovation weniger planbar und gleichsam häufiger erlebbar ist, als Managementratgeber es nahelegen.
Der evolutionäre Charakter der Innovation
Um Innovationen adäquat verstehen zu können lohnt es, Veränderungen mit Hilfe eines soziologischen Konzepts als Ergebnis sozialer Evolution in Organisationen zu verstehen. Ob und wie sie in der Organisation Wirksamkeit entfaltet, bemisst sich dabei daran, inwiefern sie eine reale Veränderung der Strukturen nach sich zieht. Die dafür notwendige soziale Evolution setzt sich dabei aus den Elementen Variation, Selektion und Restabilisierung zusammen.
Für Organisationen bedeutet das, dass Veränderungen aus mindestens drei Gründen unwahrscheinlich und kaum planbar sind – obwohl sie ständig vorkommen.
Grund 1: Neues taucht in Organisationen zunächst als Variation auf. Die gute Nachricht für alle Innovationshungrigen ist, dass Variationen häufig auftreten und damit eben nicht seltene Glücksfälle sind. Variationen sind nämlich erst einmal nichts anderes als Abweichungen von der bestehenden Routine. Die schlechte Nachricht: die allermeisten dieser Variationen werden seitens der Organisation vergessen.
Grund 2: Wird eine neue Idee erst einmal aufgenommen und nicht vergessen, steht diese erneut am Scheideweg. Denn eine Neuerung einmal auszuprobieren, bedeutet bei weitem noch nicht, diese auch gutzuheißen und ihre Etablierung zu fördern. Auch das viel zitierte ‚schlechte Beispiel‘, an dem gerne gezeigt wird, wie man es nicht macht, bedeutet eine Bezugnahme auf die Variation und damit eine, in diesem Fall negative, Selektion. Selektion unterliegt eben immer auch der aktuellen Konfiguration des organisierten Systems. Mikropolitik oder strukturelle Zwänge, die vor wenigen Monaten andere gewesen und nächstes Jahr andere sein mögen, drücken ihr zuweilen ihren Stempel auf.
Grund 3: Gelingt es allerdings, die Abweichung vom Bestehenden positiv zu selektieren, gilt es, eine weitere Hürde zu nehmen: die der Restabilisierung. Das heißt, dass die Abweichung sich etablieren und als neuer Normalfall etablieren muss. Was zunächst banal klingt, stellt sich in der Realität nicht ganz so einfach dar. Ob dies gelingt, hängt nämlich nicht bloß vom Willen der beteiligten Akteur:innen ab, sondern vor allem davon, ob die neue Arbeitsweise oder das neue Produkt im Verhältnis der Organisation zu ihrer Umwelt bestehen kann.
Innovation, Reform, Revolution – You name it!
Was aber ist nun die spezifische Qualität des Innovativen, die sie von anderen Veränderungen abgrenzt?
Veränderungsprozesse in Organisationen sind stark beobachterabhängig. Was die Chefstrategin in der Fachpresse als Revolution anpreist, mag im Alltag der Mitarbeitenden lediglich eine Änderung der eigenen Visitenkarte zur Folge haben. Und was in den Kommunikationsabteilungen als Kleinstreform ausgeflaggt wird, mag für den Shopfloor eine radikale Umwälzung sein. Anders gesagt: Innovation ist das, was man dazu macht. Einzige Einschränkung: findet keine reale Veränderung statt, entlarvt sich die Innovationssemantik blitzschnell als diskursiver Blindgänger. Grundsätzlich steht aber jeder Wandel für einen Innovationsanstrich zur Verfügung – und die Akzeptanz dieser Semantik dürfte stärker von mikropolitischen Konstellationen und aktuellen Management-Diskursen abhängen als von konkreten Inhalten.
Warum es mehr als guten Willen braucht…
Kein Wunder, dass Unternehmen vor dieser Gemengelage nach der Beherrschbarkeit von Innovationsprozessen – d.h. also, als Innovation bezeichneten Veränderungen – dürsten. Die häufig gewählten Instrumente sind bekannt: Startups in konzerneigenen Inkubatoren, Acceleratoren in denen Ideen vorangetrieben werden sollen oder Kooperationen mit anderen Organisationen innerhalb und außerhalb der eigenen Branche oder gar des Wirtschaftssystems. Und während sich dabei immer wieder fruchtbare Konstellationen ergeben, gilt für viele dieser Initiativen eben auch, dass sie ohne ernsthaften Einfluss auf die Mutterorganisation bleiben.
Mit Blick auf das skizzierte Evolutionsmodell und die häufig nur lose Kopplung von realer Veränderung und Innovationssemantik kann das kaum überraschen. Denn die Förderung neuer Ideen ist nur eines von mehreren Erfolgskriterien. Selektion und Restabilisierung, so der Eindruck, sind im Gegensatz dazu landläufig als kritische Erfolgsfaktoren unterschätzt. Genauso verwundert es wenig, wenn als Innovationen gestempelte Initiativen, die schlussendlich alles beim Alten lassen, Hochglanz-Papiertiger bleiben, die eher in belustigten Runden auf Firmenfeiern für Furore sorgen als im Arbeitsalltag.
…und was Innovation als Führungsaufgabe wirklich ausmacht
Wer neue Lösungen jenseits der Anhäufung von Variationen unterstützen möchte, ist aber in jedem Fall gut beraten, Irritationen des Bestehenden in der eigenen Organisation zu verankern. Konkret heißt das, die bestehenden Erwartungen hin und wieder als das sichtbar werden zu lassen, was sie immer schon sind: kontingent. Diese Kontingenz bleibt in der Regel im Alltag latent – nur so können Strukturen ausreichend Orientierung bieten. Will man Abweichung ermutigen und deren Etablierung positiv verstärken, kann es helfen, diese Kontingenzfenster bewusst zu öffnen – und den Willen zur Veränderung nicht nur kommunikativ zu adressieren, sondern durch Führung und Entscheidung konkret zum Ausdruck zu bringen. Dazu gehört dann aber auch, die geöffneten Kontingenzräume rechtzeitig wieder zu schließen und Neuerungen sozusagen in der Organisation ankommen zu lassen.
Ebenso gilt, allzu lose Kopplungen von Innovations-Sprech und Veränderungsprozessen zu vermeiden. Eine entsprechende Semantik zu bemühen, sollte eher als strategische Entscheidung denn als beliebig addierbares Gimmick verstanden werden. Als Begleitinstrument zu initiiertem Wandel kann eine Innovationssemantik hilfreich sein: sie rückt den Wandel in ein positives Licht und erleichtert es Akteur:innen, an neu eingeschlagene Wege anzuschließen – ohne das Alte diskreditieren zu müssen. Sie kann auch dabei helfen, positive Entwicklung, die bisher unterhalb der organisationalen Wahrnehmungsschwelle lagen, bei Bedarf sichtbar zu machen.
Eine sparsame Verwendung des Innovationsbegriffs wäre dementsprechend eine wünschenswerte Innovation in der Unternehmenslandschaft – zumindest, wenn man sie als solche beobachten möchte.