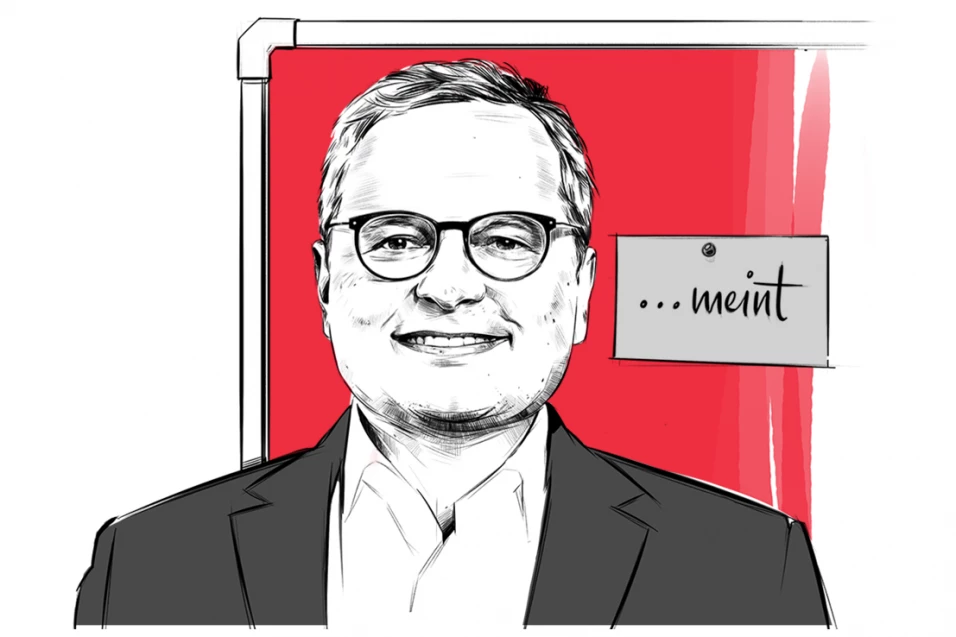Dies ist der zweite Teil einer mehrteiligen Serie über Strategiearbeit. In der Reihe bereits erschienen: Was stoppt das „Weiter so“?
Ich gehe für diese Reihe von einer Organisation aus, die dringend etwas ändern muss. Im ersten Teil ging es darum, wie herausforderungsvoll es ist, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Diese vorausgesetzt, diskutiert dieser Teil, wie eine Organisation neue Handlungsmöglichkeiten entdecken kann.
„Was können wir anders machen? Wo haben wir schon erste Ansätze?“ Mit diesem schlicht anmutenden Fragepaar lässt sich ein gutes Stück Strategieprozess produktiv bestreiten. Vorausgesetzt, die Organisation lässt bei aller krisenbedingten Dringlichkeit noch Fragen zu.
Wie es auch gehen kann (nur: nicht erfolgreich), habe ich bei der Beratung eines Strategieprozesses in einem Familienunternehmens erlebt. Der Prozess lief, die Ausarbeitung der Optionen machte Fortschritte. Da wurde eines Morgens der gesamte Vorstand zur Sitzung mit dem Patriarchen einberufen. Der Patriarch verkündete; er habe die Idee für die strategische Neuausrichtung gehabt. Sie sei bereits ausformuliert, und könne jetzt in der Organisation verkündet werden. Jedes Vorstandsmitglied bekam ein Handout gereicht. Echter Service also – und ein Prozess in Scherben. Die Chance, neue Gedanken in die Unternehmensstrategie aufzunehmen, wurde durch Hybris, einen freien Abend und zwei Flaschen Rotwein erfolgreich verhindert.
Zwei Suchrichtungen für Antworten
Wo findet man stattdessen die neuen Möglichkeiten? In den meisten Fällen gehe ich vom „Mittelpunkt“ der Organisation aus; also dem, was aktuell als Kerngeschäft verstanden wird. Von dort aus kann man dann zwei Wege nehmen. Der eine führt entlang einer zeitlichen Achse: Wie hat das Geschäft früher ausgesehen und was sind mögliche Zukünfte?
Aber: „Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie Zukunft betreffen“, sollen sowohl Winston Churchill als auch Mark Twain und Niels Bohr gesagt haben. Egal wer es war, richtig ist wohl: Das Ausarbeiten von brauchbaren Zukunftsszenarien ist mit hohem Aufwand verbunden. Und auch die Suche in der Vergangenheit nach Ansätzen, die immer noch oder heute wieder passen, kostet Zeit. So vielversprechend also diese Suchrichtung scheint, sie hilft bei unmittelbar erlebtem Handlungsdruck (von dem ich wie beschrieben ausgehe) eher nicht weiter.
Für kurzfristiges Handeln eignet sich mehr der Blick nach links und rechts: in die äußere und innere Umwelt der Organisation. Und auch wenn es schnell gehen muss, möchte ich zuerst von der schnellsten und einfachsten Möglichkeit abraten:
Benchmark, die Axt unter den Strategietools
Benchmarks zu verwenden, ist der typische Reflex angesichts einer Krise. Sie verschiebt die Frage nach der Strategie vom offenen Suchen auf eine quantifizierbare, leichter zu vergleichende Ebene. Die Frage ist dann nicht mehr „Was können wir anders machen?“, sondern „Wie können wir effizienter werden?“ Was in der Regel bedeutet: Wie viele Mitarbeitende müssen gehen?
Benchmarking ist das Gegenteil von Innovation. Es ist das Abwenden von der Idee, ein besonderes Unternehmen zu sein, das eine besondere Lösung anbietet. Benchmarking heißt, sich willentlich auf das zweckrationale Effizienzgedrängel im Mittelfeld einzulassen, statt nach dem besonderen Element („Superpower“ nannte ich das im ersten Teil) zu suchen, welches die eigene Geschäftsidee von der der Konkurrenz unterscheidet.
Die äußere Umwelt befragen – und nicht messen
Auf Wettbewerber zu schauen, ist richtig und gehört zur Suche nach Antworten dazu. Und doch ist es hilfreicher, das Gespräch zu suchen, statt Organisationsdynamiken in Zahlenwerte zu pressen. Austausch mit direkten Wettbewerbern pflegen zu können, ist natürlich ein Privileg: Eher kleine und mittelständische Unternehmen kommen in diesen Genuss. Die Maschinenbaubranche macht vor, wie trotz Konkurrenzsituation ein Abgleich der Realitäten möglich ist. Wenigstens die Frage „Spinnen wir, oder spinnen unsere Kunden?“ kann diskutiert werden, ohne Betriebsgeheimnisse preis zu geben.
Mit Kunden zu reden, liefert immer wieder auch überraschende Erkenntnisse. Besonders ehrliche Antworten auf seine Fragen bekommt man, wenn genügend zeitlicher oder kontextueller Abstand zum letzten oder nächsten Kauf besteht. Das Erkunden der Welt des Kunden gelingt nur, wenn im Gespräch ein Geben und Nehmen angelegt ist, ungetrübt von unmittelbarer kommerzieller Absicht.
Kratzer fürs Ego gibt es garantiert bei einer anderen Informationsquelle: ehemalige Kunden, die einst regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen erworben haben, aber damit irgendwann aufhörten. Wer es schafft, aufrichtiges Interesse zu signalisieren und es dem Gegenüber ermöglicht, die Informationshürden aus Takt und Höflichkeit zu überwinden, kann hier einige schmerzhafte Wahrheiten über die eigene Organisation (bzw. das Produkt) erfahren.
Die innere Umwelt anhören
Was allen Organisationen zur Verfügung steht, sind die eigenen Mitglieder. Auch hier liegt großes Potenzial für die Organisation, über Dinge zu sprechen, nach denen sie unter normalen Umständen nicht fragt und die sie zumeist nicht hören will. Sie muss dafür nur das Gespräch mit jenen suchen, die man im Alltag üblicherweise bremst:
- die jungen Mitarbeitenden, die vom Trott der Organisation noch nicht gänzlich eingenommen wurden – und sich deshalb noch über Dinge wundern können
- die Querköpfe, die eher eine Idee zu viel als zu wenig haben und sich oft mit den gegebenen Verhältnissen reiben
- die Mitglieder an den Grenzstellen, die für die Umwelt zuständig sind und Wünsche, Frust oder Irritationen aus nächster Nähe erleben und normalerweise aus den Organisationsabläufen raushalten
Für all das braucht es Gesprächsformate, in denen diese Gruppen geschützt sprechen können. Über neue Ideen und Potenziale, die die Organisation verwirklichen könnte – bisher aber Tabu waren. Über Geschäftsmodelle und -prozesse, die schon existieren – aber formal nicht existieren dürften. Es braucht Formate, die mindestens implizit signalisieren: Um taktlose Antwort wird gebeten!
Illegitime Geschäftsmodelle legitimieren: ein Beispiel
Ein Fall aus dem Maschinenbau zeigt, was bei solchen Gesprächen erfahrbar ist: Ein Hersteller möchte ein Modell abkündigen; der Nachfolger ist entwickelt und erprobt, der Verkauf läuft. Es ist also Zeit, die Herstellung der alten Maschine einzustellen und Ressourcen in der Produktion freizumachen.
Und dann steht der Außendienstmitarbeiter mit dem frischen Portfolio und großartigen Angeboten bei seinem Stammkunden auf dem Hof und will ihm die neuen Möglichkeiten anpreisen. Doch der ist nicht zu überzeugen. „Ich will nichts Neues“, ist die Aussage. „Ich habe eine komplexe, gut laufende Produktionsstrecke. Da muss nur diese Maschine ausgetauscht werden. Sie muss exakt das Gleiche können, die gleichen Maße haben, die gleiche Rolle übernehmen.“
Nach einem Besuch der Produktion (vielleicht finden sich doch noch Argumente für die neue Maschine?) bleibt dem Vertriebler nichts anderes, als seinem Kunden zuzustimmen: Es ist eine kleine, passgenaue Lücke, in einer langen Kette. Zu versuchen, hier den (von ihm erwarteten) Verkauf der neuen Maschine durchzudrücken, ergibt keinen Sinn. Also wird das Gespräch mit der Produktion gesucht. Man einigt sich auf kurzem Dienstweg: Die Maschine wird hergestellt – ein letztes Mal!
Das könnte lediglich eine Randnotiz zu Ausnahmeregelungen im Sinne der Kundenorientierung sein. Jedoch ist dieses “letzte Mal” so üblich, dass der Umsatzposten mit „End of lifetime“-Maschinen bei einigen Herstellern eine signifikante Größe in der Jahresbilanz einnimmt.
Hat die Organisation einmal gehört und verstanden, wie regelmäßig dieser Ausnahmebedarf besteht, kann sie damit anders umgehen. Dann wird das Portfolio noch um den Bereich „Retro Fitting“ ergänzt: Ersatzteile und alte Maschinen können weiterhin geliefert werden. Und dass es eine Ausnahme ist, die Mehraufwand in der Produktion verursacht, rechtfertigt ein neues Preisschild.
Möglichkeiten sammeln, Sanktionsfreiheit signalisieren
Unabhängig davon, ob es um Prozesse geht, die in der Organisation bereits im Gang sind, oder Möglichkeiten und Chancen, die bisher nur in Köpfen vorhanden sind: Für beides ist das Signal von Sanktionsfreiheit wichtig. Es ist die falsche Zeit, um Exempel zu statuieren an jenen, die sich nicht an den Prozess gehalten haben. Und es ist die falsche Zeit für den Sprechakt, „Wenn Sie so wunderbare Ideen haben, warum übernehmen Sie nicht auch gleich die Umsetzung?“ Beides stellt nur sicher, dass die Organisation weit weniger über sich selbst und ihre Chancen kennenlernen wird, als möglich ist.
Aus den gesammelten Handlungsmöglichkeiten, aus den Eindrücken davon, was innere und äußere Umwelt für denkbar halten (oder im Verborgenen schon gedacht haben) – ergibt sich schließlich, was Organisationen in Schieflage häufig viel zu früh tun: Es werden Entscheidungen über eine neue Richtung getroffen.
Aber diese Entscheidungen sind das Thema der nächsten Kolumne.
… to be continued…