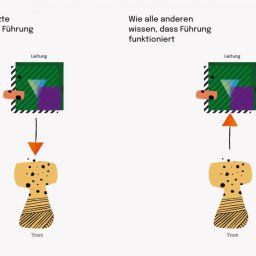Organisationen lieben klar umrissene Aufgaben und fest vereinbarte Erwartungen. Bestenfalls ist immer eindeutig geregelt, wer „sich hinter die Sache klemmt“, „den Ball fängt“ oder „das Thema auf der Agenda hat“ – um nur ein paar Phrasen zu zitieren, wie Verantwortlichkeiten im organisationalen Alltag benannt werden.
Doch manchmal scheint es auch zu helfen, ein Gremium oder die ganze Organisation verantwortlich zu machen. Wie bewegt man sich zwischen diesen beiden Polen? Das ist Thema dieser Folge.
Skript zum Gespräch
Andreas Hermwille: Warum gibt es in Organisationen dieses große Bedürfnis, Schuldige zu benennen, wenn Fehler passiert sind?
Stefan Kühl: Die Personalisierung und Zurechnung des Fehlers auf eine Stelle oder eine Person ist eine hervorragende Möglichkeit, zu signalisieren: Wir bearbeiten das Problem. Deswegen braucht man in dem Moment, wo etwas schief läuft, einen Schuldigen, der symbolisch abgestraft und entfernt werden kann. Auf diese Weise ist die Organisation von dem entlastet, was da stattgefunden hat – unabhängig davon, ob die identifizierte Person für den Fehler tatsächlich verantwortlich ist.
Andreas Hermwille: Das heißt, es geht gar nicht darum, aus Fehlern zu lernen?
Stefan Kühl: Dass Organisationen aus Fehlern lernen ist eine naive Vorstellung. Meistens erschöpft sich die Organisation in dem Prozess, die Verantwortlichen zu finden und den Fehler zu personalisieren, und kommt gar nicht mehr dazu, systematisch die Ursachen anzugehen.
Verantwortung übernehmen vs. als Verantwortliche*r unterschreiben
Andreas Hermwille: Fehler zu personalisieren ist alsoeine Möglichkeit für Organisationen, mit Fehltritten umzugehen – aber was hat die Organisation davon?
Stefan Kühl: Um das zu verstehen hilft eine kleine Begriffsunterscheidung, die Niklas Luhmann eingeführt hat, nämlich der Unterschied zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Verantwortung bedeutet, dass in Organisationen Unsicherheit absorbiert werden muss. Es geht darum, in einer Welt, in der alles möglich ist, Sicherheiten zu produzieren. Und das können alle Mitarbeiter*innen machen. Man ist in Organisationen permanent damit beschäftigt, Probleme zu lösen, egal ob man dafür vorgesehen ist oder nicht. Das heißt, es gibt im organisationalen Alltag einen Mechanismus von Verantwortungsübernahme, der aber nicht damit identisch ist, dass man auch eine Verantwortlichkeit hat.
Schwierig wird es, wenn die Verantwortung ganz woanders getragen wird als dort, wo die Verantwortlichkeit liegt.
Verantwortlichkeit ist der Mechanismus, der stattfindet wenn etwas schief geht. Dann fragt man: Wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Fehler passiert ist? Verantwortlichkeiten legt man fest, weil man im Zweifelsfall daraus ableiten kann, wer Schuld ist. Und die Personen mit Verantwortlichkeiten leiten natürlich daraus auch bestimmte Rechte ab. Wenn sie am Ende ihren Kopf hinhalten müssen, wollen die meisten die Entscheidung auch wirklich mittragen. Schwierig wird es, wenn die Verantwortung ganz woanders getragen wird als dort, wo die Verantwortlichkeit liegt.
Andreas Hermwille: Also die Person, die am Ende formal dafür vorgesehen ist, die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen, gar nicht unmittelbar daran beteiligt gewesen ist, sie zu treffen?
Stefan Kühl: Genau. In gewisser Weise ist das auch häufig funktional. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, vergleichsweise großzügig mit meiner eingescannten Unterschrift umzugehen. Meine Mitarbeiter*innen verfügen über meine Unterschrift und häufig weiß ich nicht, ob sie die einsetzen. Aber wenn etwas schief geht, halte ich am Ende trotzdem meinen Kopf hin. Für Organisationen ist es typisch, dass Verantwortung und Verantwortlichkeit nicht unbedingt zusammenfallen. Gleichzeitig brauchen Organisationen diesen Mechanismus der Verantwortlichkeit.
Ohne Verantwortlichkeit funktionieren Organisationen nicht
Andreas Hermwille: Allein schon die Zwecksetzung einer Organisation stelle ich mir kompliziert vor, wenn man Verantwortlichkeit vermeiden will. Irgendwer muss sich ja überlegt haben: Was tun wir in dieser Organisation? Vielleicht kann man das auch hierarchiefrei gemeinsam entscheiden, aber spätestens bei rechtlichen Fragen braucht es ja Verantwortlichkeiten.
Stefan Kühl: Ja, und dann ist es plötzlich extrem relevant, ob eine Unterschrift vorhanden ist oder nicht. Gerade im Katastrophenfall werden gern auch einmal Verantwortlichkeiten hin und her geschoben – und dann ist es wichtig, dass genau in der Struktur der Organisation definiert ist, wo die Verantwortlichkeit für eine bestimmte Entscheidung liegt.
Andreas Hermwille: Die Funktionalität liegt also häufig in der Zurechenbarkeit von Entscheidungen.
Stefan Kühl: Um ein Beispiel zu nennen: Aktuell ist die Haftbarkeit von Geschäftsführung und Vorstand gerade in Unternehmen und Verwaltung extrem angestiegen, so dass man in bestimmten Organisationen, wenn man nicht aufpasst, zivilrechtlich oder strafrechtlich belangt werden kann. Aus meiner Sicht ist das der einzige Grund, weswegen in Organisationen die sogenannten Compliance Abteilungen, die für die Regeleinhaltung zuständig sind, extrem wachsen – häufig bis zu einer Dysfunktionalität in der Organisation.
Compliance-Abteilungen sind vorrangig dafür da, im Schadensfall die Verantwortlichkeit von der Spitze der Organisation abzupuffern.
Im Zweifelsfall können Vorstände oder Geschäftsführer*innen sich dann mit dem Argument zurückziehen, dass sie doch diese Spezialabteilung für Compliance haben. Compliance Abteilungen sind vorrangig dafür da, im Schadensfall die Verantwortlichkeit von der Spitze der Organisation abzupuffern. Und die Compliance Abteilungen geben den Regulierungs- und Formalisierungsdruck in die Organisation weiter.
Andreas Hermwille: Innerhalb der Compliance Abteilung ist es vermutlich dann nicht ganz so einfach, konkrete persönlich verantwortliche Personen zu benennen? Vermutlich bekomman ja nicht einzelne Mitarbeitende die präzise Aufgabe, „Du überwacht jetzt unseren CFO“, sondern es gibt Teams für bestimmte Bereiche?
Stefan Kühl: Auch Compliance Abteilungen haben in der Regel klar umrissene Verantwortlichkeiten. Und wenn es nicht dezentral geregelt ist, ist automatisch die Person an der Spitze verantwortlich. In dem Moment, wo die Spitze extrem präzise die Stelle jedes einzelnen Mitarbeitenden beschreibt, kann Verantwortlichkeit nach unten abgeben werden.
Kollektives Entscheiden führt zu Verantwortungsdiffusion
Andreas Hermwille: Das heißt in dem Moment, wo Aufgaben und Zuständigkeiten präzise beschrieben sind, kann man auch präzise nachvollziehen, wer verantwortlich ist.
Stefan Kühl: Die Mitarbeitenden können sich auch darauf zurückziehen, wenn sie nicht verantwortlich sind, wenn es außerhalb ihres Verantwortungsbereichs geschehen ist. Interessant sind kollektive Entscheidungen. Wenn viele Personen an Entscheidungen beteiligt sind, geschieht häufig etwas, was man „Verantwortungsdiffusion“ nennen kann – es ist nicht mehr eindeutig zurechenbar, wer verantwortlich ist.
Andreas Hermwille: Verantwortungsdiffusion klingt nach etwas, was man auf keinen Fall will. Was ist denn der Nutzen davon, eine Gruppe verantwortlich machen zu können?
Stefan Kühl: Der Diskurs um kollektives Entscheiden wird von der Idee getrieben, dass möglichst viele Personen an Organisationsprozessen beteiligt sind, wobei Partizipation positiv bewertet wird – wenn sie sich z. B. den Agilitätsdiskurs anschauen oder die Debatten zu neuen Organisationsformen. Wenn viele Mitarbeitende an Entscheidungen beteiligt werden, nimmt einerseits die Risikobereitschaft zu, weil angenommen wird, dass die Verantwortlichkeit diffundiert und man als Einzelperson nicht belangt wird, wenn es schief geht. Andererseits kann passieren, dass die Organisation blockiert, weil es die Sorge gibt, dass man als Teil des Entscheidungsgremiums dorch irgendwie verantwortlich gemacht wird und man sich deshalb lieber zurückhält, was eine gewisse Passivität der ganzen Organisation zur Folge haben kann.
Andreas Hermwille: Was ist mit so wechselseitigen Checks and Balances, wo man sich verantwortlich erklärt, die gemeinsam getroffene Entscheidung gemeinsam zu tragen?
Stefan Kühl: Der interessante Effekt ist, dass man sich in Workshops häufig zu diesen gemeinsam getroffenen Entscheidungen committed, aber in dem Moment, wo der Druck dieser konkreten Interaktionssituation wegfällt, die Sache schon wieder anders aussieht – wenn’s dann in die Hose geht, möchte es niemand gewesen sein. Umgekehrt passiert gerne auch, dass wenn die Umsetzung hervorragend funktioniert, ganz viele Hände hochgehen und sagen „übrigens, das war meine Idee“. Das heißt die Erinnerung der einzelnen Person, was sie eigentlich gemacht und welche Entscheidung sie getroffen hat, verändert sich gern je nachdem wie diese Entscheidung im Nachhinein in der Organisation beurteilt wird.
Andreas Hermwille: Könnte man vielleicht sagen: Je größer der Personenkreis, desto diffuser und abstrakter ist auch die Beschreibung des umschriebenen Verantwortungsbereichs?
Stefan Kühl: Wenn viele Personen an Entscheidungen beteiligt werden kann man beobachten, dass „Formelkompromisse“ entstehen, die letztlich nicht viel darüber aussagen, was operativ eigentlich geschehen soll. In Workshops wird ganz häufig der Fehler gemacht, dass man versucht, zu einer Entscheidung zu kommen und einen Konsens herzustellen. Dieser Konsens kann dann häufig nur ein Formelkompromiss sein, weil die Differenzen viel zu groß sind. Wenn die Hierarchie im Workshop anwesend ist, sollte sie sich nicht dazu drängen lassen, Entscheidungen im Workshop selbst zu treffen, sondern darauf verweisen, dass diese Diskussionen wirklich sehr interessant sind, man aber gerne noch einmal eine Nacht darüber schlafen möchte. So wird auch deutlich markiert, dass die Verantwortlichkeit für die Entscheidung übernommen wird.
Wer auf Hierarchien verzichtet, trifft weniger riskante Entscheidungen
Stefan Kühl: Es gibt aber auch Organisationen, die hierarchielos funktionieren und bewusst keine verantwortlichen Personen festlegen, aber trotzdem Entscheidungen treffen müssen, zum Beispiel Fridays for Future oder politische Basisorganisationen. In der Regel haben diese Organisationen extreme Schwierigkeiten damit, schnell auf Veränderungen in ihrer Umwelt zu reagieren und innovativ zu sein. Das liegt daran, dass sie meistens strukturkonservativ aufgebaut sind, also man aufgrund des Verzichtes auf hervorgehobene Hierarchiepositionen letztlich eher am status quo festhält.
Andreas Hermwille: Weil man eine Vollversammlung braucht, um Entscheidungen zu treffen – und in diesen Formen von Interaktion nicht zu innovativen Entscheidungen kommt, nehme ich an?
Stefan Kühl: Genau. Organisationen, die auf Hierarchien und damit auch auf Verantwortlichkeiten verzichten, sind meistens extrem zurückhaltend damit, riskante Entscheidungen zu treffen. Man könnte sagen, dass der Verzicht auf hierarchische Strukturen und somit auch auf die Benennung von persönlichen Verantwortlichkeiten zwangsläufig zur Folge hat, dass diese Organisationen sich langsamer entwickeln und an vorhandenen Strukturen festgehalten wird.