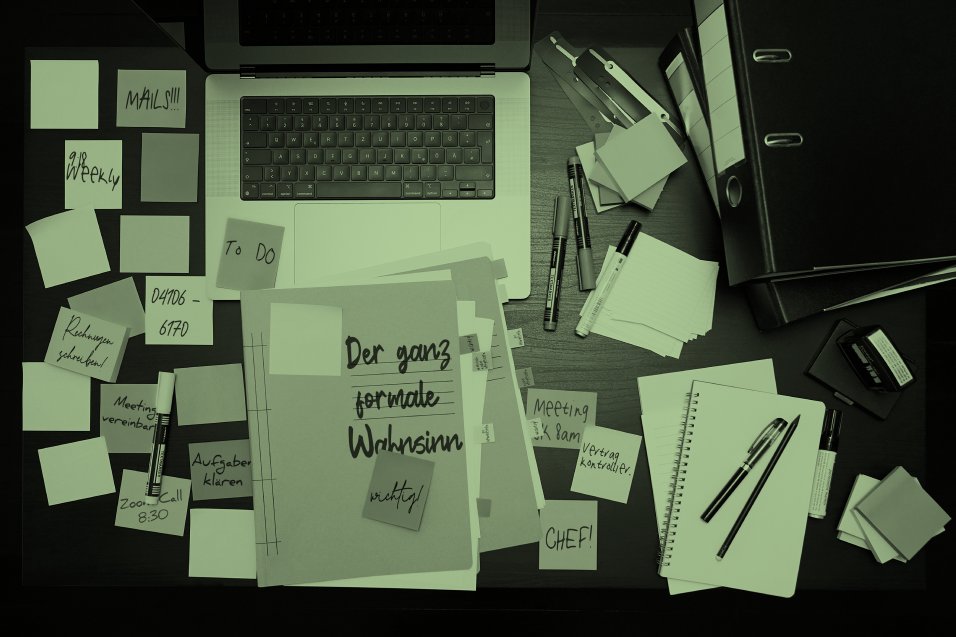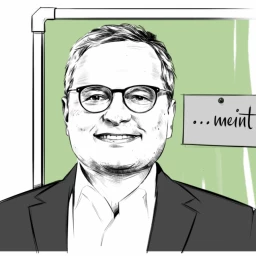Eine Zeit lang forderten die Installationsprogramme von Mobiltelefonen als erstes ihre Nutzer auf, ein persönliches Mission Statement, ein individualisiertes Leitbild einzugeben. Irritiert fragte man sich, ob die sich zunehmend als künstlich intelligent präsentierenden Mobiltelefone zukünftig die Eingabe von allen Terminen blockieren werden, die nicht mit dem eigenen Leitbild kompatibel sind. Während die Erstellung persönlicher Leitbilder uns ungewöhnlich, ja fast schon abstrus erscheint, ist dies in Organisationen längst an der Tagesordnung. Unternehmen, aber auch Verwaltungen, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen und Kindergärten, die etwas auf sich halten, bieten ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten einen Wertekanon an, der Orientierung in der alltäglichen organisatorischen Unübersichtlichkeit bieten soll.
Die Leitbilder klingen alle überraschend ähnlich. So präsentierte IBM lange Zeit ein Leitbild, das den Dienst am Kunden, die Verpflichtung gegenüber den Aktionären, ein faires Verhalten gegenüber den Lieferanten und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft verkündete. Das technologische Gemischtwarenunternehmen 3M verkündete als gemeinsame Werte im Unternehmen absolute Integrität, die Achtung individueller Initiative, Toleranz gegenüber Fehlern „in bester Absicht“ sowie qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte.
Leitbilder sind meist zu abstrakt
Die Crux ist, dass Leitbilder so abstrakt formuliert sind, dass sie sich nicht als Grundlage für konkrete Handlungsempfehlungen eignen.[1] Ob man sich jetzt in einer Konfliktsituation eher zugunsten des Kunden, des Aktionärs, des Lieferanten oder der Gesellschaft entscheiden soll, ließ das Leitbild von IBM offen. Ob der Mitarbeiter bei 3M für eine Innovation einen Fehler „in bester Absicht“ riskieren oder sich für den sicheren Weg entscheiden sollte, um ein zuverlässiges Produkt abzuliefern, wurde durch das Leitbild ebenso unklar gelassen.
Handlungsempfehlungen in Leitbildern verhalten sich zueinander wie die beiden Arme einer Küchenwaage. Je allgemeiner die Handlungsempfehlungen und je abstrakter der Wertekatalog einer Organisation formuliert sind, desto weniger können Mitarbeiter daraus schließen, wie sie sich konkret verhalten sollen. Je stärker jedoch ein Leitbild konkrete Handlungsanweisungen vorgibt, desto weniger integrierend kann es wirken, desto stärker dringen die Widersprüchlichkeiten der Organisation an die Oberfläche, desto stärker ähneln sie verbindlichen formalen Regeln.[2]
Der Bezug auf Werte sollt Legitimität verschaffen
Aber vielleicht ist die mangelnde Fähigkeit, über Leitbilder Verhalten zu steuern, gar nicht so schlimm. Vielleicht geht es bei Leitbildern ja gar nicht darum, sondern eher um die Produktion von Legitimität für das Unternehmen, die Verwaltung, das Krankenhaus, die Universität, die Schule oder den Kindergarten. Leitbilder scheinen die Ablagefläche für alle nicht-ökonomischen Ansprüche zu sein, die von außen an eine Organisation herangetragen werden. Ein Unternehmen, das als einziges Ziel Profit, Profit, Profit ausgibt, gerät auch in einer Marktwirtschaft in Rechtfertigungsprobleme. Mitarbeiter wollen das Gefühl haben, dass sie täglich acht, neun oder zehn Stunden nicht allein für den schnöden Mammon aufwenden, sondern Teil einer größeren Sache sind. Kunden lassen sich besser binden, wenn man ihnen vermittelt, dass sie nicht gemolken werden, sondern im Mittelpunkt des Unternehmens stehen.
Die Erzeugung dieser Form der Akzeptanz ist die klassische Aufgabe der Leitung. Dem Mitarbeiter am Fließband oder der Pflegerin auf der Krebsstation ist der Ruf ihrer Organisation zwar in der Regel nicht egal, schließlich muss man sich gegenüber seinen Freunden rechtfertigen, aber für die Reputation ist die Spitze zuständig. Das erklärt auch, weswegen das Top-Management und bestenfalls noch die Leitbildbeauftragten mit besonderem Herzblut an dem Wertekatalog hängen, Mitarbeiter die Leitbildkampagnen jedoch mehr oder minder über sich ergehen lassen.
Mitarbeiter wollen das Gefühl haben, dass sie täglich acht, neun oder zehn Stunden nicht allein für den schnöden Mammon aufwenden, sondern Teil einer größeren Sache sind. Kunden lassen sich besser binden, wenn man ihnen vermittelt, dass sie nicht gemolken werden, sondern im Mittelpunkt des Unternehmens stehen.
Die Erstellung des Leitbildes ist allerdings schwieriger, als man auf den ersten Blick denken mag. Einerseits darf das Leitbild nicht verstauben, anderseits darf man sein Leitbild nicht zu häufig wechseln, weil sich die Mitarbeiter sonst nur noch über die jeweils aktuelle „Jahreslosung“ lustig machen würden. Auf der einen Seite darf das Leitbild nicht zu weit von den in der Gesellschaft gehandelten Werten abweichen. Man stelle sich nur ein Leitbild vor, das trotz der demokratischen Grundstimmung eine autoritäre Führung für das Unternehmen fordert. Auf der anderen Seite darf es aber auch nicht eine billige Kopie des Wertekatalogs eines anderen Unternehmens sein.[3] Leitbilderstellung ist immer eine Gradwanderung zwischen diesen Polen und allein deswegen schon ein aufwendiger Prozess, der sich nicht standardisieren lässt – weder bei Organisationsleitbildern noch bei persönlichen Mission Statements. Es ist also unwahrscheinlich, dass uns in der nächsten Softwareversion eines Handys eine Programmerweiterung nach zwei Jahren automatisch zur Erneuerung unseres Mission Statements auffordert und das Mobiltelefon einen Warnhinweis gibt, wenn unser persönliches Leitbild zu stark denen anderer Nutzer ähnelt.
[1] Siehe zu diesem Merkmal von Werten allgemein Niklas Luhmann: Rechtssoziologie. Reinbek 1972, 88f.
[2] Siehe dazu Stefan Kühl, Hansjörg Mauch, Christoph Nahrholdt: Leitbilder richtig entwickeln. In: HarvardBusinessManager (2015), 10, S. 56–65.
[3] Siehe ausführlich dazu Stefan Kühl: Leitbilder erarbeiten. Eine kurze organisationstheoretisch orientierte Handreich. Wiesbaden 2017.