Ich habe ein neues Genre fiktionaler Literatur entdeckt. Die Entdeckung geschah ohne Absicht. Am liebsten wäre ich mit den Texten des Genres nie in Berührung gekommen. Und doch muss ich sie professionsbedingt hin und wieder lesen, ärgere mich dann über das Gelesene und finde mich schließlich von den eigentlichen Gegenständen meiner Profession, die mir Freude machen, abgelenkt.
Deswegen ist die Kundgebung meiner Entdeckung auch gleichermaßen ein Ausspeichern: Hier kann der Ärger pointiert seinen Platz finden und ich ihn ziehen lassen.
Die neue Form der Dichtung, die mich so verstimmt ärgert, ist die „Case Study“. Case Studies sind kein neues Phänomen – doch wofür ich mich nun halb im Ernst einsetzen möchte, ist eine Umsortierung im Bücherregal: Raus aus der Sachliteratur, oder gar aus dem akademischen Kontext. Rüber zu den Business- und Wirtschaftskrimis, die mit den verheißungsvollen Worten „Nach einer wahren Begebenheit“ eröffnen. Da weiß man als Leserin und Leser: Jetzt wird es nicht nur unterhaltsam. Es wird auch Fuß- und Endnoten zu finden geben, die einordnen, wo die gestraffte und hoffentlich spannende Erzählung noch Kontakt zu den realen Abläufen behalten hat. Man muss diesen Ergänzungen gar nicht nachgehen. Es tut dem Lesefluss gerade gut zu wissen, dass die komplexeren Zusammenhänge zwar irgendwo geschrieben stehen – aber nicht dort, wo es gerade spannend wird.
Case Studies bedienen sich der gleichen Technik: Wie in einem guten Roman werden nur die Dinge erzählt, die auf dem Weg zum großen Knall oder zum großen Wunder wichtig waren. „Wie wurde Nintendo so erfolgreich?“ „Woran ist Kodak gescheitert?“ Diese Fragen heben besondere Ereignisse in der Geschichte eines Unternehmens hervor und lassen sie zu Meilensteinen auf dem Weg zum Ziel (bzw. zum Abgrund) werden.
Gut aufgebaute Case Studies machen deutlich, wie das eine zum anderen geführt hat. Welche Opfer nötig waren, wie die Hindernisse aus dem Weg geräumt wurden, um am Ende den Ring in den Schicksalsberg – pardon, die Nintendo Switch zum Marktführer zu befördern. Die große Auflösung Z war nur möglich, weil die Schritte A, B, C bis X und Y in genau der Reihe erfolgt sind. Um der puren Lesbarkeit willen werden die Erfolgs- und Niedergangsgeschichten von Unternehmen genauso zugespitzt erzählt, wie man es aus einem Populär-Roman kennt. Solche Texte sind fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann.
Damit bin ich vollständig einverstanden, es macht solche Geschichten ja konsumierbar. Was mich aber ärgert, sind die Anleihen aus der Wissenschaft, die vor allem dazu dienen, den fiktionalen Charakter der Textsorte zu verschleiern. Sie nennen sich nicht Erfolgsgeschichten – sondern „Case Studies“. Sie enden nicht mit der großen Katharsis, in der die Helden sich selbst erkennen – oder ihren bitteren Absturz – sondern mit vermeintlich logischen Ableitungen aus vermeintlich eindeutigen Kausalzusammenhängen, am besten in grafisch hervorgehobenen „Your Take Away for Business“-Lösungsboxen.
Die dargestellten Handlungs- und Nachahmungsvorschläge sehen nur so lange gut aus, solange man in der Lage ist, einen nicht auflösbaren Logikfehler zu ignorieren: Case Studies können nur deswegen Meilensteine und besondere Entscheidungen hervorheben, deuten und die Zusammenhänge zwischen einer Kette von Entscheidungen analysieren, weil sie die Vergangenheit beschreiben. Die Autorinnen und Autoren haben beim Schreiben ihrer Geschichte den Luxus zu wissen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Sie wissen, welche Entscheidungen kritisch und welche irrelevant gewesen sein werden. Und natürlich haben sie in der Beobachtung ein Bias, nämlich gerade die Handlungen hervorzuheben und als kritisch zu beschreiben, die dem vorentschiedenen „Take Away“ als starkes Argument dienen.
Ziehen Sie die richtigen Lehren aus diesem Case! Implementieren Sie mit uns die Sieger-Strategie™. Werden Sie mit uns failsafe-proof™.
Das alles ist an sich ein legitimes Geschäftsmodell. Wir als Metaplan beschreiben ebenfalls anhand von Fällen aus der Vergangenheit, wie wir in der Gegenwart arbeiten. Dabei ist eine entscheidende Frage aber die, welche Schlussfolgerungen man aus dem konkreten Einzelfall, den man beschreibt, am Ende zieht. Und die Scharlatanerie beginnt dort, wo aus dem Einzelfall einfache und eindeutige Lehren für alle Fälle gezogen werden.
Es ist sicher hilfreich, viele Erfolgs- und Niedergangsgeschichten zu kennen – allein, um die eigenen Entscheidungen damit legitimieren zu können, dass es andere ebenso gemacht haben und damit erfolgreich waren.
Aber im Moment der Gegenwart stellen sich alle Gabelungen der Zukunft als gleichwertig dar. Und Entscheiden wird immer mit einem Grad an Unsicherheitsüberwindung verbunden sein – denn wo keine Unsicherheiten wegentschieden werden mussten, da musste man gar nicht entscheiden, da konnte man einfach handeln. Da hilft die schönste Case Study nichts.
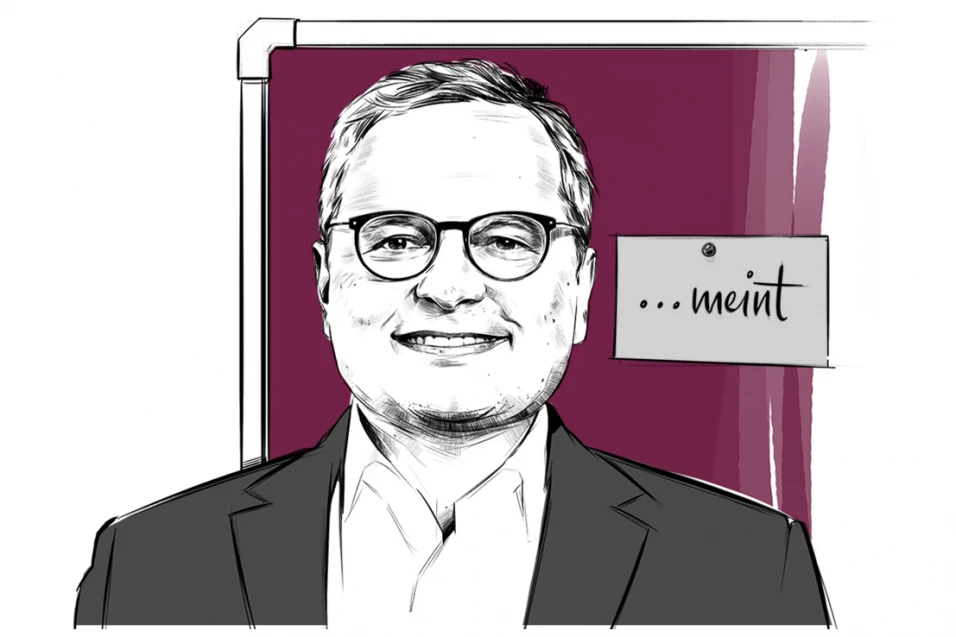

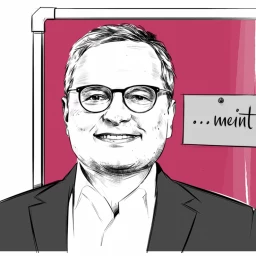
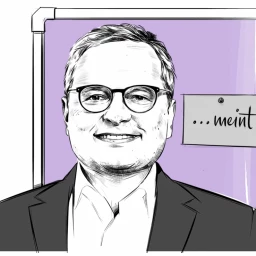
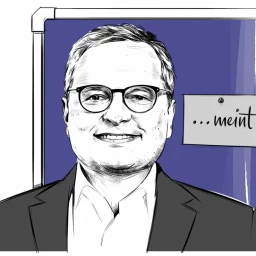
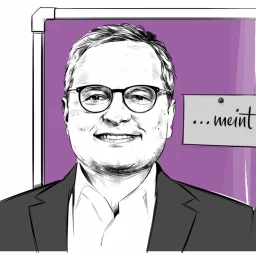
Kommentar (1)
Coole Herangehensweise Kai! Mein großes Learning dabei war eine Case Study an der Harvard Business School zur Challenger Katastrophe von 1996.
Während die Case Study alle Ursachen und Zusammenhänge gut zur Schau stellte, kam Richard Feynman in seinem Buch zu einer sehr interessanten Ursache am Schluss der Untersuchungen. Die wahre Absturzursache war eine „Kultur der Nichtunterstützung der Kollegen“ beim Feststoff-Raketen Hersteller. Dr zuständige Ingenieur hat verzweifelt darauf hingewiesen – wurde aber ignoriert vom System. Das hat meine Technik/Management Karriere sehr stark beeinflusst. Antwort heute: wir müssen wieder mehr auf die Soft Facts allein schon wegen der Nachhaltigkeit und der Motivation der Mitarbeiter schauen. Case Studies sind Infos – es ist wie bei der KI – der menschliche Geist prägt/kreiert/interpretiert die Soft Facts! Grüße dich aus Tirol / Hannes