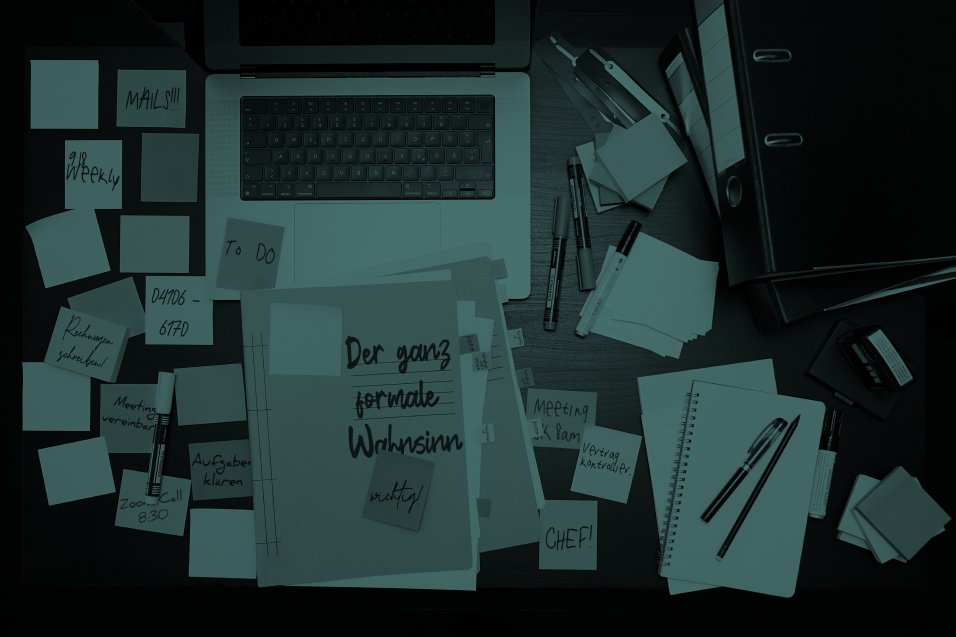Unter manchen Managern herrscht die Vorstellung, ihre Organisation bestände nur aufgrund der in ihnen arbeitenden Menschen. Nicht selten fordern manche Führungskräfte in Reden vor Mitarbeitern in Schulungsseminaren oder in den Hochglanzbroschüren daher, dass sich die Angestellten mit ihrer ganzen Persönlichkeit ins Unternehmen einbringen sollen. Aber was würde passieren, wenn dies Wirklichkeit werden würde?
Unternehmen, Verwaltungen und Verbände zeichnen sich dadurch aus, dass sie von den individuellen Interessen ihrer Mitarbeiter abstrahieren. Kurz gesagt: Organisationen bestehen nur, weil sie Mechanismen entwickelt haben, die dazu in der Lage sind, die Vielzahl an verschiedenen individuellen Interessen, die in die Firma hineingetragen werden, zu disziplinieren. Mit der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages erklärt sich ein neuer Mitarbeiter bereit, seine persönlichen Vorlieben zurückzustellen und in den Mittelpunkt seines Handelns stattdessen die von der Organisation geforderten Rollenerwartungen zu stellen, also von eigenen Interessen zu abstrahieren und sich erst einmal auf die Regeln des Systems einzulassen. Organisationen existieren also gerade deswegen, weil Mitarbeiter einen großen Teil ihrer Hoffnungen, Probleme und Erwartungen in den Empfangshallen des Firmengebäudes abgeben und sich eben nicht mit ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen.
Organisationen sind nicht Freundesgruppen
Der Trick, der an dieser Stelle zum Tragen kommt, wird von Soziologen als „konditionierte Mitgliedschaft“ bezeichnet. Die Mitgliedschaft in einem Unternehmen, einer Verwaltung oder einer Universität ist an die Anerkennung von Erwartungen geknüpft, die die Organisation an ihre Mitglieder stellt. Wenn ein Organisationsmitglied auch nur eine Weisung seines Vorgesetzen aus Prinzip nicht akzeptiert oder einer Vorschrift grundsätzlich die Anerkennung verweigert, rebelliert er damit nicht nur gegen diese eine Anweisung oder Vorschrift, sondern gegen die Grundsätze dieser Organisation insgesamt.
Entlang dieser Beobachtung lässt sich der zentrale Unterschied zwischen Unternehmen, Verwaltungen oder Krankenhäusern auf der einen sowie Freundesgruppen auf der anderen Seite festmachen: Bei Cliquen von Freunden kann man den legitimen Anspruch stellen, dass sich alle mit ihrer ganzen Person einbringen können und sollen – also einschließlich ihrer persönlichen, beruflichen, handwerklichen, religiösen sowie sportlichen Hoffnungen und Sorgen. Man trifft und liebt sich wegen der Persönlichkeit. Man kommuniziert vorrangig, um Beziehungen aufzubauen, ohne dass es unbedingt eine konkrete Aufgabe geben muss.
In Organisationen geht es dagegen nicht darum, interessante, nette und liebenswerte Menschen kennenzulernen, sondern vielmehr darum, Tätigkeiten und Informationen so miteinander zu verknüpfen, dass man Lösungen für anstehende Aufgaben finden kann. Das kann die Entwicklung eines neuen Automobils, die Herstellung eines Schreibtisches oder das Gewinnen eines großen Bauprojektes sein. Zwar wird das Kennenlernen interessanter, netter und liebenswerter Menschen nicht von vornherein ausgeschlossen, aber man kann sich vorstellen, was passieren würde, wenn ein Mitarbeiter seinen Kontaktbedürfnissen höhere Priorität einräumen würde als der Entwicklung des Automobils, der Herstellung des Schreibtisches oder dem Gewinnen des Großprojektes.
Es kann nie um den ganzen Menschen gehen
Wenn Organisationen das „Menschliche“ in ihre Organisationspolitik wieder einführen, dann mag das zwar eine ideologische Bedeutung haben, aber es handelt sich nur um die sehr begrenzte Wiedereinführung von etwas, was an sich ausgeschlossen ist. Durch Betriebsfeste, humanistisch aufgeklärte Leitbilder oder psychologisch orientierte Kommunikationstrainings versucht die Organisation letztlich nur das „Menschliche“, was sie eigentlich ausschließt, in niedrigen, gut zu beherrschenden Dosierungen wieder hineinzulassen. Was passiert nun, wenn in einer Organisation unter dem Schlagwort der „Mitarbeiterorientierung“ die stärkere Einbindung der Mitarbeiter sowie das Berücksichtigen individueller Interessen gefordert wird?
Durch die Mitarbeiterorientierung werden die „Dressierungen“ der individuellen, lokalen Interessen, quasi der Status quo der Regulierung, aufgelockert. Die Positionen, Rollen und Regeln, die Organisationen sich mühsam aufgebaut haben, werden tendenziell in Frage gestellt: Die Forderung, dass sich Mitarbeiter mit ihrer ganzen Person einbringen sollen, ist letztlich gleichzusetzen mit der Aufforderung, ihre eigenen, durch die Organisation nicht voreilig disziplinierten Vorstellungen, Wünsche und Idee einzubringen. Das kann sicherlich belebend wirken – die Mobilisierung von individuellen Interessen, persönlichen Vorlieben und interessanten Abweichungen führt zur Vielfalt in Organisationen. So kann die Erstarrung des Systems in ihren formalisierten Rollen und Regeln verhindert werden und ihren Anteil zum Erfolg einer Organisation beitragen. Es kann durchaus vorteilhaft sein, wenn nicht alle Mitarbeiter das „Unternehmen im Blut“ haben, sondern das Gefüge durch ihre Abweichungen, Macken und Skurrilitäten nicht zur Ruhe kommen lassen.
Zu viel Mitarbeiterorientierung desintegriert die Organisation
Aber trotz aller vermeintlichen Vorteile darf nicht vergessen werden, dass die Mobilisierung von Vorstellungen, Wünschen und Ideen tendenziell immer den Mechanismus in Organisationen unterläuft, sich gegen die Persönlichkeit des Angestellten abzugrenzen. Organisationen, die sich (zu) stark auf die Bedürfnisse und Auffassungen ihrer Mitarbeiter einlassen, verlieren den Zusammenhalt. Sie werden zu einem Haufen ungebündelter Entscheidungen. Sie drohen, je nach Perspektive, zu einem Freundeskreis aufzusteigen oder zu verkommen.
Organisationen stehen also vor dem grundlegenden Problem, dass sie auf der einen Seite darauf angewiesen sind, die lokalen Interessen und persönlichen Wünsche auszublenden, auf der anderen Seite aber genau diese Interessen auch einbeziehen müssen – weil sie anders keine Mitarbeiter für die Organisation gewinnen können. Das Management steckt in einem von Cornelius Costoriadis beschriebenen Dilemma: Die Organisation kann einerseits das Einbringen der Mitarbeiter mit ihrer ganzen Person gebrauchen. Nur so wird die Erstarrung von formalisierten Regeln und Rollen verhindert. Andererseits ist die Organisation auf die Eingrenzung und Ausblendung lokaler und begrenzter Interessen angewiesen, weil nur so das Grundprinzip in Form von formalisierten Regeln und Rollen aufrechterhalten werden kann.[1]
[1] Cornelius Castoriadis: Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie. Frankfurt a.M. 1997, 164ff.