In den letzten hundert Jahren haben Organisationen vielfältige Mechanismen entwickelt, um ihre Umwelt methodisch zu erfassen. Unternehmen fingen an, systematisch Markt- und Konsumforschung auszubilden, Trendforscher zu beschäftigen und Konkurrenzanalysen zu betreiben. Es entstanden Verbände, deren Aufgabe darin bestand, politische Veränderungen zu beobachten und diese in leicht verständlicher Form an ihre Mitgliedsorganisationen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, den Massenmedien oder der Gesundheitsversorgung zu melden. Parteien begannen, Wahlforschungsinstitute zu beauftragen, um herauszufinden, was ihre Wähler wollen und wie sie sich von anderen Parteien abgrenzen können. Selbst Verwaltungen, Universitäten und Gefängnisse fingen an, unter dem Label des Qualitätsmanagements die Zufriedenheit ihrer „Kunden“ abzufragen.[1]
Der Hintergrund war, dass die Organisationen zunehmend den Eindruck entwickelt hatten, ihre Umwelt werde mehr und mehr zu einer „Blackbox“, von deren Inhalt sie nur eine sehr vage Vorstellung hätten. Der Wahrnehmung vieler Organisationen folgend bestanden zwischen dem, was sie selbst zu leisten im Stande waren, und dem, was die Umwelt an Leistungen abzunehmen bereit war, „Gräben“, „Schluchten“ und „Berge“, die sich lediglich durch „Kundschafter“, „Scouts“ und „Pfadfinder“ in Form von Markt-, Trend- oder Wahlforschern überwinden ließen.[2]
Klassischerweise wird in der Marktforschung davon ausgegangen, dass sich Organisationen bei der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen an den Bedürfnissen ihrer Endabnehmer orientieren. Unternehmen – so die Annahme – würden die Wünsche ihrer Kunden „erforschen“ und ihre Produktinnovationen dann auf diese Begehren hin ausrichten. Auf ganz ähnliche Weise hätten auch Parteien ihr Ohr am Mund ihrer Wählerklientel und würden ihre Programme entsprechend dieser Rückmeldungen modifizieren.
Die Organisationsforschung hat jedoch herausgearbeitet, dass sich viele Organisationen nicht am Markt orientieren, sondern an Konkurrenten im gleichen organisationalen Feld.[3] Wir wissen aufgrund von Studien über so unterschiedliche Branchen wie das Hotel- und Gaststättenwesen, den Maschinenbau und die Entwicklungshilfe, dass die Diffusion von Innovationen in der Regel nicht auf die sich verändernde Nachfrage von Kunden, sondern auf die Beobachtung von konkurrierenden Anbietern zurückzuführen ist.[4]
Die Orientierung an der Konkurrenz statt am Verbraucher ist funktional. Die Wünsche von möglichen Käufern sind für Leistungsanbieter in vielen Fällen nur schwer zu erheben, weil die Informationen nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Schlimmer noch – häufig weiß der Konsument selbst gar nicht so genau, was er eigentlich will. Konkurrenten sind dagegen deutlich einfacher zu beobachten und zu durchschauen. Während die Produktwünsche eines Kunden häufig vage bleiben, sind die Erzeugnisse der Konkurrenten transparent. Zwar mag oftmals nicht klar sein, was potenzielle Verbraucher für ein Produkt zu zahlen bereit sind, doch sind die Preise der Konkurrenten leicht zu ermitteln. Systemtheoretisch ausgedrückt: In dem Maße, in dem eine Umwelt komplex ist, weicht man darauf aus, andere Beobachter zu beobachten.[5]
[1] Siehe ausführlich dazu Stefan Kühl: Märkte explorieren. Eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Wiesbaden 2017.
[2] Siehe dazu Kai-Uwe Hellmann: Nachwort. In: Dominik Schrage, Markus R. Friederici (Hrsg.): Zwischen Methodenpluralismus und Datenhandel. Zur Soziologie der kommerziellen Konsumforschung. Wiesbaden 2010, S. 191–199, 192f.
[3] Hierzu klassisch Harrison C.White: Where Do Markets Come From? In: American Journal of Sociology 87 (1981), S. 517–547.
[4] Zu Hotels Theresa K. Lant, Joel A.C Baum: Cognitive Sources of Socially Constructed Competitive Groups. In: W. Richard Scott, Soren Christensen (Hrsg.): The Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks 1995, S. 15–38.; zum Maschinenbau Martin Heidenreich, Gert Schmidt: Informatisierung, Arbeitsorganisation und Organisationskultur. Eine vergleichende Analyse der Einführung von Informationssystemen in italienischen, französischen und deutschen Unternehmen. Bielefeld 1992.; zur Entwicklungshilfe Stefan Kühl: Capacity Development as the Model for Development Aid Organizations. In: Development and Change 40 (2009), S. 1–27.
[5] Niklas Luhmann: Risiko und Gefahr. In: ders. (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen 1990, S. 131–169, hier S. 191.
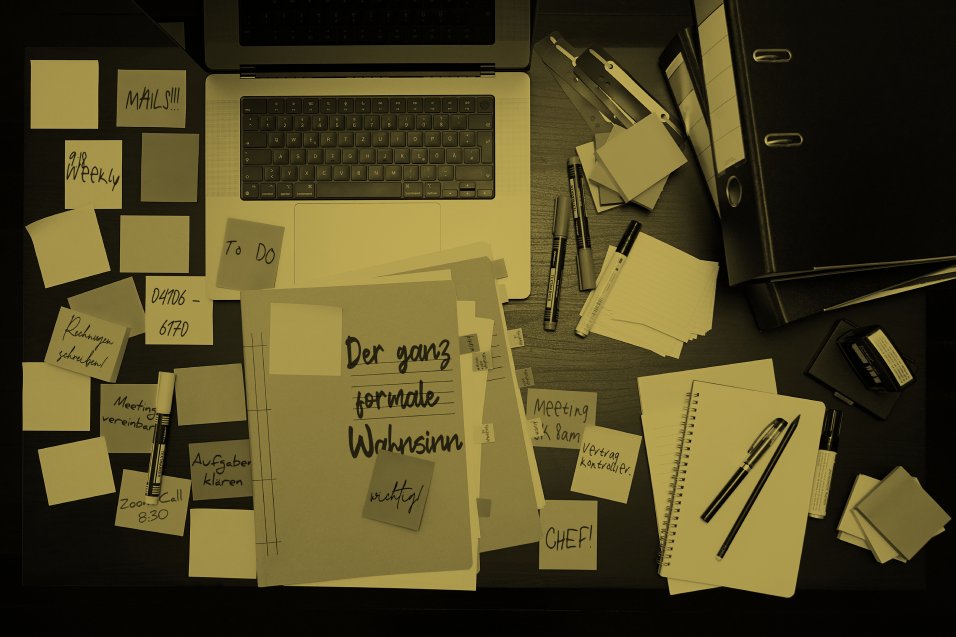





Kommentar (1)
In meiner Zeit als Produktmanager ist mir aufgefallen, dass ich sehr langsam bin, wenn ich erst mühsam versuche, im Gespräch mit Kunden deren Wünsche herauszufinden. In der gleichen Zeit, in der ich auf diesem Weg ein neues Produkt auf den Markt bringe, entwickle ich vier andere, die ich mir bei der Konkurrenz abgucke, wenn ich weiß, dass sie bei den Konkurrenten erfolgreich laufen, dort aber Schwächen haben, die ich in meiner Version optimiere. Produktimitation nennt man das im Produktmanagement. Der Zeitgewinn macht diese Methode so verlockend und die Möglichkeit, aus den Fehlern der Konkurrenz zu lernen, sie nicht wiederholen zu müssen. Der Blick auf die Konkurrenz wird allerdings dann zum Problem, wenn man in einer lahmenden Branche feststeckt, wenn man es also mit Konkurrenten zu tun hat, die mehr und mehr am Kunden vorbeiproduzieren und wenn parallel dazu Kanalkonkurrenz auf dem Vormarsch ist, die durch disruptive Techniken die Platzhirsche von dereinst vom Markt fegen will und nach einiger Zeit auch wird. Das Ideal bleibt daher der Blick auf den Kunden, auf das Marktumfeld. Man muss ein Unternehmen von außen nach innen führen, heißt es bei Malik und er empfiehlt Kunden, Staat, Medien, Arbeitnehmer, Konkurrenten, Lieferanten, Geldgeber ständig im Blick zu haben.